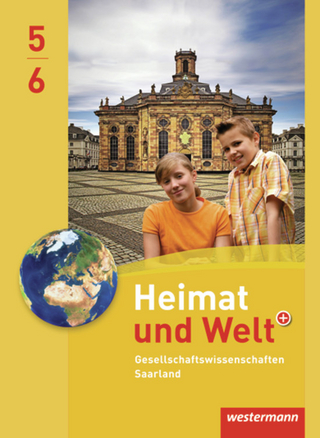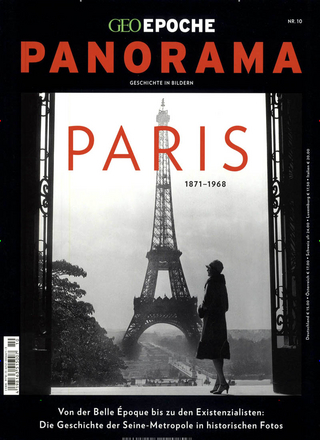"Der Krieg hat uns geprägt"
Campus (Verlag)
978-3-593-38447-4 (ISBN)
- Titel ist leider vergriffen, Neuauflage unbestimmt
- Artikel merken
Für ihre Dokumentation der kindlichen Kriegserlebnisse hat Margarete Dörr mehr als 500 Lebensgeschichten in mündlicher und schriftlicher Form gesammelt. Hinzu kommen Tagebücher, Briefe, Fotos und andere persönliche Dokumente. In 22 Kapiteln stellt sie die vielfältigen Aspekte des Lebens von Kindern im und nach dem Zweiten Weltkrieg in deren eigenen Worten dar. Dabei interpretiert und kommentiert sie die Geschichten vor dem Hintergrund der historischen Ereignisse. Die Schrecken des Krieges sind ebenso Thema wie die nationalsozialistische Erziehung, die Verbrechen des Regimes und der Übergang in eine neue Diktatur in der sowjetisch besetzten Zone. Erstmals kommen auch die donauschwäbischen und russlanddeutschen Kinder in den Blick. Zum Abschluss reflektieren die ehemaligen Kriegskinder, wie der Krieg ihr Leben und ihr Weltbild geprägt hat. Das Buch ist ein Beitrag zum Verständnis nicht nur der Generation, die hier zu Wort kommt. Deutlich wird auch, was deren Prägung für die kulturelle und politische Wirklichkeit unseres Landes bis heute bedeutet.
Margarete Dörr, geboren 1928,war Gymnasiallehrerin und Fachleiterin für Geschichte am Seminar für Studienreferendare in Stuttgart und Heilbronn. Zusätzlich hatte sie einen Lehrauftrag für Fachdidaktik an der Universität Stuttgart. Bei Campus erschien von ihr 1998 »›Wer die Zeit nicht miterlebt hat …‹ Frauenerfahrungen im Zweiten Weltkrieg und in den Jahren danach«.
Inhalt Band 1
Einleitung 7
Kapitel 1
Der Krieg – ein fernes Erdbeben?26
Kapitel 2
Kriegsspiele – Kriegshelden 47
Kapitel 3
Fasziniert, indoktriniert. Im Zwiespalt?69
Kapitel 4
Keller, Bunker, Bomben103
Kapitel 5
Tiefflieger, Einsatz unter Bomben und Beschuss, Nachwirkungen des Luftkriegs156
Kapitel 6
Verschickt 190
Kapitel 7
Kindersoldaten 243
Kapitel 8
Kriegsende und Besatzer287
Kapitel 9
Auf der Flucht 344
Kapitel 10
Als Fremde in der Heimat, in Internierungslagern 394
Kapitel 11
Verwaist – verloren – verschleppt – vertrieben 440
Kapitel 12
Ankommen – »Flüchtlingskind« – Heimat 491
Anmerkungen zu Band 1533
Inhalt Band 2
Kapitel 13
Donauschwaben, Russlanddeutsche7
Kapitel 14
Trümmerkinder und Überlebenshelfer59
Kapitel 15
Wer und wo ist mein Vater?108
Kapitel 16
Von der braunen in die rote Diktatur. Grenzgänger in Deutschland 158
Kapitel 17
Meine Mutter 206
Kapitel 18
»Die Nazis – das waren die anderen«? – »Täter-Kinder« 234
Kapitel 19
»Volksschädlinge«, Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter 297
Kapitel 20
Verfolgt 352
Kapitel 21
Rückschau nach 60 Jahren 397
Kapitel 22
Gelebte Versöhnung 444
Anmerkungen zu Band 2475
Literaturverzeichnis502
Wortlaut des Fragebriefes an die Zeitzeugen 522
Der Jahrgang 1929 und zum Teil noch der Jahrgang 1930 wurden regulär zur Wehrmacht eingezogen. Hierzu gab es zwei sich scheinbar widersprechende Anweisungen. Martin Bormann ordnete am 27.2.1945 an, den Jahrgang 1929 dem Volkssturm einzugliedern. Generalfeldmarschall Keitel verfügte am 5.3., mit der Dienstverpflichtung des Jahrgangs 1929 zu beginnen. Der scheinbare Widerspruch löst sich, wenn man mit Karl Heinz Jahnke annimmt, dass Bormann diejenigen im Blick hatte, die wegen der Nähe der Front gar keine reguläre Ausbildung mehr bekommen konnten oder zum Militärdienst ungeeignet waren. Sie sollten, so wie sie waren, dem Volkssturm einverleibt werden. Schon im Januar 1945 war die Entscheidung gefallen, in einer zentralen Aktion 60.000 15-jährige Jungen für den Dienst bei den RAD(Reichsarbeitsdienst)-Flakbatterien einzuberufen. In der Anweisung hieß es: »Im Gegensatz zur Aktion der Luftwaffenhelfer werden die Jugendlichen nicht notdienstverpflichtet, sondern als RAD-Männer gemustert und einberufen, auch wenn das 16. Lebensjahr noch nicht erreicht sein sollte.« Wie sie auf den Kampf eingestimmt wurden, zeigt der Aufruf des Reichsjugendführers Arthur Axmann: »Ich weiß, dass der Jahrgang 1929 dem Jahrgang 1928 in seiner Entschlossenheit, für die Freiheit und eine glückliche Zukunft zu kämpfen, in nichts nachstehen wird. Der Feind steht in unserer Heimat und bedroht unmittelbar unser Leben. Bevor wir uns vernichten oder knechten lassen, wollen wir zäh und beharrlich bis zum endlichen Siege kämpfen.« Dass es um »Sein oder Nichtsein« gehe und dass der Endsieg gewiss sei, hatten die meisten dieser Jungen schon lange verinnerlicht. Aus dem Tagebuch von Reinhard Gröper (1929), der mit seiner Klasse von Stuttgart nach Rottweil in die Kinderlandverschickung gekommen war: »April. (1945) Die Kriegslage: Im Westen: Der Feind steht überall am Rhein. Kämpfe im Rothaargebirge. Feindliche Panzerspitzen vor Kassel. Der Feind aus Aschaffenburg geworfen. Kämpfe im Odenwald und am unteren Neckar. Im Osten: Kampf in Ostpreußen. Kampf um Danzig, Stettin, Küstrin, Glogau und Breslau. Schlacht im Raum Strehlen und von Ratibor. Kämpfe im slowakischen Erzgebirge bei Neusohl. Russen teilweise an der Grenze der Ostmark. – Die Lage ist nicht gerade rosig, aber es ist kein Grund da, den Kopf hängen zu lassen oder gar am deutschen Sieg zu zweifeln.« Aus dem Tagebuch von Karl Heinz Mehler (1929), im KLV-Lager Titisee im Schwarzwald: »2. IV. 45, Montag. Mittags tummelten wir uns im Gelände herum. Warfen am Bach auf kleine Schiffchen und trieben lauter so Zeug. Das Wetter geht so. Die Sonne verschwindet nur alle Augenblicke hinter den Wolken. Das Essen ist zur Zeit nicht gerade reichlich. Ja, wir sind halt alle im Wachsen, und da könnte man essen wie ein Drescher. Aber ich glaube, wir müssen uns dies Jahr noch auf kleinere Rationen umstellen, denn mit der Ernährungslage sieht es jetzt nicht mehr so gut aus. Es fehlt überhaupt an vielem. Doch man würde alles gerne ertragen, wenn man ein gutes Ende voraussehen könnte, aber zur Zeit trüben für uns dunkle Wolken den Himmel. Aber nur Mut, es muss gelingen. Ich weiß, dass wir noch an die Front kommen, und ich habe eigentlich keine Angst davor. Wenn ich nur wüsste, dass meine Eltern in Sicherheit wären.« Er schildert dann seine Einberufung, Einkleidung, Ausbildung und den Einsatz: »Am 17. April 1945 war es dann für uns Schüler des Jahrgangs 1929 so weit. Auch wir wurden zum Militärdienst eingezogen. Zuvor fand in Titisee eine ärztliche Untersuchung statt, bei der nur einige etwas schwächliche Schüler ausgesondert wurden. Von einem, Werner Brehm, habe ich später erfahren, dass er bitterlich geweint hat, denn er wollte unbedingt mit seinen Kameraden in den Krieg ziehen. Der Lagerleiter verabschiedete uns mit den salbungsvollen Worten: ›Nun ziehet dahin und lebet wohl. Kämpfet tapfer für das Vaterland und kehret gesund wieder.‹ … Als wir in Triberg ankamen, standen die französischen Truppen nicht mehr weit davon entfernt. Wir wurden in aller Eile eingekleidet, und zwar erhielten wir eine ungewöhnliche olivfarbene Uniform. Vermutlich wurden Restbestände der ›Organisation Todt‹ für unsere Einkleidung verwendet. Eine kurze Ausbildung am Karabiner und an der Panzerfaust folgte in Schonach am 20. April 1945, also zu Hitlers Geburtstag, unsere Vereidigung und danach der sofortige Abmarsch in Richtung Bodensee. Die Einheit, zu der wir zählten, nannte sich HJ-Panzervernichtungsregiment 21-Baden. Sie bestand ausschließlich aus Jugendlichen unseres Jahrgangs. Außer uns Mittelschülern gehörten auch viele Jugendliche aus dem Schwarzwald zu diesem ›letzten Aufgebot‹. Die Unteroffiziere und Offiziere waren Wehrmachtsangehörige, von denen wir nicht wussten, woher sie kamen. Wir folgten ihren Befehlen, so wie wir das gelernt hatten. Der »Militärdienst« bestand dann im Requirieren von Fahrrädern, und am 29. April wurden sie bei Immenstadt tatsächlich auf einer Anhöhe postiert, von wo aus sie angebliche französische Fahrzeuge beschießen sollten. Dabei töteten sie vermutlich einen deutschen Arbeitsdienstmann. Französische Fahrzeuge tauchten nicht auf. In Blaichach sahen sie auch freigelassene Häftlinge in ihren gestreiften Anzügen. Dass dort ein KZ gewesen war, erfuhr Karl Heinz erst lange nach dem Krieg. »Gegen 17 Uhr fuhren französische Panzerspähwagen in Blaichach ein und begannen, mit Maschinengewehren das Feuer auf das Gebäude zu eröffnen, in dem wir uns befanden. Wahrscheinlich waren sie von den Häftlingen auf diesen Standort aufmerksam gemacht worden. Ich sah, wie ein Offizier durch ein Hinterfenster hechtete und folgte ihm in Panik. Der Spurt über die hinter dem Haus liegende Wiese in den nahegelegenen Wald brachte mich in Sicherheit.« Dort traf er noch auf drei seiner Kameraden. »Wir waren wahrscheinlich alle dem ›Heldentod‹ sehr nahe gewesen, viel näher, als wir es wahrgenommen haben.« Am 1. Mai gerieten sie bei Steibis dann ganz undramatisch in französische Kriegsgefangenschaft, aus der er erst im Frühjahr 1947 zurückkehrte. Aber längst nicht alle waren begeistert, als sie einrücken mussten. Die Zeichen der Auflösung waren unübersehbar. Klaus L. (1929), der zuvor in einem sehr anstrengenden Fabrikeinsatz gewesen war und mit großer Freude erfahren hatte, dass er am 1. April 1945 seine Lehre als Bankkaufmann beginnen könne, schreibt: »Doch die Freude währte nicht lange. Am 12. März erhielt ich den Einberufungsbefehl vom Wehrmeldeamt Ludwigsburg, einrücken am 29. März 1945. An diesem Tag war ich gerade mal 15 Jahre und 4 Monate alt. So um den 10. bis 22. März hörte man gerüchteweise, dass die amerikanischen Truppen bei Mannheim stehen sollten. Ich überlegte jetzt hin und her, was ich machen sollte, aber meine Tante Maria sagte zu mir, wenn du nicht gehst, ist das Fahnenflucht, und das wird hart bestraft. Meine Mutter sagte, geh aufs Rathaus und frage, was du machen sollst. Das tat ich dann auch. Hätte ich es lieber nicht gemacht, denn dort wollte ich dem Polizeioberleutnant Christian H. klarmachen, dass es doch nichts mehr nütze, wenn ich jetzt noch meinem Einberufungsbefehl Folge leiste. Der aber schrie mich an, hieß mich einen Feigling und Vaterlandsverräter, ich wäre am liebsten in den Boden versunken. Ich konnte froh sein, dass er mich nicht gleich einsperrte. So blieb mir nichts anderes übrig, als mich auf meine Abreise vorzubereiten … Im Flur beim Wehrmeldeamt in Ludwigsburg lief mir ein Wehrmachtsunteroffizier über den Weg, und ich frage ihn nach der RAD-Dienststelle. Er sagte mir, dass die meisten von denen schon getürmt sind und die noch da waren, wären alle besoffen. Er sagte mir noch, da ist in den nächsten paar Stunden nichts zu machen, die müssten zuerst ihre Räusche ausschlafen. Was sollte ich nun machen? Im Treppenhaus traf ich dann noch einen älteren Nachbarn aus Bietigheim. Er wurde auch noch einberufen. Er war in Wehrmachtsuniform und fragte mich, was um Himmels willen ich da mache. Ich erklärte ihm alles, und er schüttelte nur den Kopf und meinte, am besten wäre es, wenn ich mit dem nächsten Zug wieder nach Hause fahre.« Klaus aber hatte Angst vor der Polizei und versuchte, zu Fuß nach Hause zu kommen. Er traf unterwegs noch andere Jungen, sie waren zu sieben. Ein Wehrmachtsauto sammelte sie ein und fuhr sie direkt vor die Türe des RAD-Lagers in Sulzbach. Es hing sehr von den örtlichen Parteifunktionären und den einzelnen Kommandeuren ab, wie ernst sie die Befehle und Anordnungen »von oben« noch nahmen und welches Verantwortungsgefühl sie diesen Kindern gegenüber hatten. Viele von ihnen waren ja selbst Väter und schöpften im allgemeinen Durcheinander ihren Handlungsspielraum zugunsten dieser Kinder voll aus. Am gefürchtetsten war bis zum Ende die SS. Die meisten Jungen versuchten mit allen Mitteln, der Waffen-SS zu entkommen. Diese wiederum bot alles auf, um möglichst viele noch zu rekrutieren, machte regelrecht Jagd auf sie, sammelte sie von der Straße ein. SS-Werber erschienen in den Schulen und in der Kinderlandverschickung und übten massiven Druck auf die Jungen aus. Es gab eine sichere Möglichkeit, der SS zu entgehen, wenn man sich freiwillig rechtzeitig zur Wehrmacht – dabei konnte man die Gattung meist noch selbst wählen – oder als Bewerber für die Offizierslaufbahn meldete. Schon 14-Jährige konnten unterschreiben, ohne die Eltern fragen zu müssen.
| Zusatzinfo | 190 sw Abb. |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Maße | 152 x 228 mm |
| Gewicht | 2034 g |
| Einbandart | gebunden im Schuber |
| Themenwelt | Geschichte ► Allgemeine Geschichte ► 1918 bis 1945 |
| Schlagworte | 2. Weltkrieg • 2. Weltkrieg / Zweiter Weltkrieg • Deutschland • Drittes Reich • Drittes Reich / 3. Reich • Erinnerungen • Kindheit • Kriegskind • Nationalsozialismus • Oral History • Zweiter Weltkrieg |
| ISBN-10 | 3-593-38447-7 / 3593384477 |
| ISBN-13 | 978-3-593-38447-4 / 9783593384474 |
| Zustand | Neuware |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
aus dem Bereich