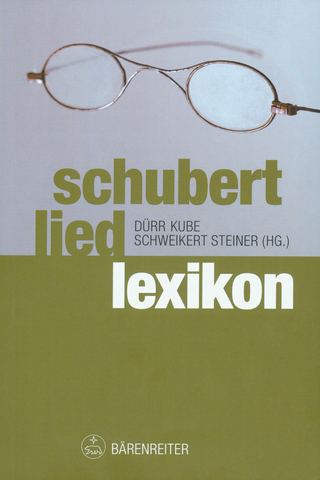" Diess herrliche,imponirende Instrument"
Breitkopf & Härtel (Verlag)
978-3-7651-0441-1 (ISBN)
Dr. des. Anselm Hartinger, geboren 1971, war lange Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bach-Archiv Leipzig sowie an der Schola Cantorum Basiliensis und ist gegenwärtig Kurator für historische Musikinstrumente am Württembergischen Landesmuseum Stuttgart.
Christoph Wolff, geboren 1940, ist Direktor des Leipziger BachArchivs, Ordinarius für Musikwissenschaft an der Harvard University und Honorarprofessor der Universität Freiburg. Er veröffentlichte zahlreiche Beiträge zur Musikgeschichte des 15. bis 20. Jahrhunderts, vor allem zu Bach und Mozart. Für seine wissenschaftlichen Arbeiten erhielt er 1978 die DentMedaille der Royal Musical Association in London, 1992 den Staatspreis des Landes Nordrhein-Westfalen und 1996 den Forschungspreis der Alexander von Humboldt-Stiftung. 1999 entdeckte er in Kiew den verlorengeglaubten Nachlaß des Bach Sohnes Carl Philipp Emanuel mit einer großen Zahl bisher unbekannter Kompositionen sowie Handschriften seiner Brüder und seines Vaters.
Peter Wollny ist als Leitender Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bach-Archiv Leipzig tätig und unterrichtet als Lehrbeauftragter an den Universitäten Leipzig, Dresden und Weimar. Er ist Autor und Herausgeber zahlreicher Publikationen zur Musikgeschichte des 17. und 18. Jahrhunderts.
Inhaltsverzeichnis 1. Edler, A. 'Weltstoff durch Weltkraft in Bewegung gesetzt'2. Meischein, B. Stimmung, Choral und Text3. Wegscheider, K. Zur Klanggestalt der Orgeln von Carl August Buchholz4. Zehnder, J.-Cl. Tanzen oder Schwimmen5. Wolf, W. Orgelkomposition nach Bach6. Wollny, P. Zur Bach-Rezeption in den Orgelwerken von Felix Mendelssohn Bartholdy7. Lutz, R. Eine Orgelsonate über den Choral 'O Haupt voll Blut und Wunden'?8. Thistlethwaite, N. Mendelssohn und die englische Orgel9. Little, Wm. A. Little Mendelssohn in Birmingham 1837 und 184010. Zepf, M. Felix Mendelssohn Bartholdy in Süddeutschland11. Stinson, R. Anmerkungen zu Mendelssohns Rezeption von Bachs Orgelwerken12. Maul, M. 'aber, sey auch seiner werth!'13. Hartinger, A. Das Orgelkonzert nach 180014. Rosenmüller, A. Carl Ferdinand Becker und die Organistenausbildung am Leipziger Konservatorium15. Kaufmann, Chr. 'Es ist also sicherer, auf alle Fälle gefasst zu seyn'16. Glöckner, A. Bach-Organisten des frühen 19. Jahrhunderts und ihr Repertoire17. Blanken, Chr. Zwischen Improvisation, Repertoire und Verlag18. Synofzik, Th. 'Ich lasse mir alles von Bach gefallen'19. Lehmann, K. 'Boten des Aufschwunges'
Hr. Musikdirektor Bach spielte eine von ihm selbst (etwas zu klaviermässig) gesetzte Toccata und ein Präludium nebst Fuge von Sebastian Bach auf der Orgel mit grosser Fertigkeit. In Berlin ist es etwas seltenes, dies herrliche, imponirende Instrument einmal concertirend gebraucht zu hören. Schade nur, daß die Zahl derer, die sich für das erhabenste aller Instrumente interessiren, sich fast nur auf einen kleinern Cirkel von Kunstkennern beschränkt. […] Vor Einförmigkeit hatte sich der Concertgeber theils durch die ihn unterstützenden Männerchöre, theils durch die Verschiedenartigkeit der von ihm vorgetragenen Stücke, gesichert. Die beiden einleitenden Zitate – das erste die Rezension eines unter Mitwirkung August Wilhelm Bachs im April 1827 in der Berliner Garnisonkirche gegebenen Benefizkonzerts, das zweite der Bericht über ein Orgelkonzert des Virtuosen Ferdinand Vogel am 21. Oktober 1832 in der Paulinerkirche zu Leipzig1 – beleuchten trotz ihrer Kürze wesentliche Potentiale und Probleme des Orgelspiels in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und deuten das aufführungspraktische und ästhetische Spannungsfeld an, in dem sich die Orgel in dieser Schlüsselperiode der Herausbildung des modernen Musiklebens befand. Einerseits mehr denn je als Ausdruck des „Erhabenen“ angesehen und gerade in der Romantik von der Würde des Kirchenraums und dem Geheimnis des geistlichen Geschehens überstrahlt, sah sich die Orgel nach den in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts allenthalben bemerkbaren Transformationsprozessen in der kirchenmusikalischen Landschaft mit einem Bedeutungsverlust konfrontiert, der ihre Stellung im Musikleben ernsthaft gefährdete. Die Orgel blieb zwar als gottesdienstliches Begleitinstrument unangefochten, mit dem Ende des Generalbasszeitalters wurde sie jedoch vielerorts aus ihrer Leit- und Stützfunktion im Ensemble und damit aus der Normbesetzung von Figuralaufführungen und Oratoriendarbietungen verdrängt. Den aus der Sinfonik und Kammermusik der Zeit abgeleiteten Vorstellungen von einem dynamisch beweglichen und stufenlos farbigen Klang konnte die weithin als unflexibel oder gar „steinern“ (Moritz Hauptmann) empfundene mechanische Pfeifenorgel kaum noch entsprechen. Neuartige liturgische Erwartungshaltungen und die vom Repertoire her gemischt zusammengesetzten Kirchenkonzerte ließen dem solistischen Orgelspiel überdies nur begrenzten Raum. Dazu fanden gerade ambitionierte Orgelvorträge regelmäßig nur das Interesse einer sehr begrenzten Zahl von Kennern und Kunstfreunden. Dieser veränderte Darbietungskontext und wohl auch ein verbreiteter Rückgang insbesondere der Pedaltechnik führten im Bereich der Orgelliteratur vielfach zu einem Verlust der idiomatischen Schreibweise und einer Angleichung an klaviergeprägte Klangideale und Spielgewohnheiten, was sich nicht nur in zahlreichen „leichten“ Spielstücken, Bearbeitungen und Variationen ausdrückte, sondern auch an dem Umstand ablesen lässt, dass es sich bei einem Großteil der in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts an der Orgel dargebotenen Bach-Werke um Fugen aus dem Wohltemperierten Klavier handelte. Dennoch gehörten die Orgelmusik, der Organistenstand und der Orgelbau um und nach 1800 zu den Bereichen des Musiklebens, bei denen eine gewisse Kontinuität barocker Handwerks-, Gattungs-, Spiel- und Ausbildungstraditionen gegeben war. Vermittelt durch Schüler und Enkelschüler Bachs wie etwa Johann Christian Kittel und gestützt auf eine breite abschriftliche Verbreitung seiner Kompositionen blieben hier überdies Teile des orgelbezogenen Schaffens Bachs in einer Weise lebendig, die die lange Zeit gehegte Vorstellung einer raschen Abwendung von seiner Musik nach 1750 mehr und mehr fraglich erscheinen lässt. Welche Bedeutung die konstante Pflege Bachschen Repertoires und die nicht zuletzt mit der Tätigkeit Felix Mendelssohn Bartholdys verbundene Wiederaneignung zahlreicher Schlüsselwerke seines organistischen Oeuvres für die Entwicklung des Orgelspiels und der Orgelkomposition nach 1800 hatte, bildet eines der zentralen Themen der diesem Zeitraum gewidmeten musikhistorischen und rezeptionsgeschichtlichen Forschungen. Die für die Epoche der musikalischen Romantik so essentielle Frage nach Kontinuität und Neuanfang ist daher sowohl an die Orgelmusik als auch an den Orgelbau und das Orgelspiel der Zeit zu richten. Die neunzehn Beiträge des vorliegenden Bandes sind der Ertrag einer im Oktober 2007 in Leipzig im Rahmen des Kooperationssprojekts „Bach – Mendelssohn – Schumann“ der Leipziger Komponistenhäuser veranstalteten Tagung. Sie nehmen sich erstmals in umfassender Weise und mit dezidiert europäischer Perspektive der Bedeutung der Orgel im Zeitalter Felix Mendelssohn Bartholdys an. Dabei wurde besonderer Wert auf das Zusammenwirken ästhetischer und gattungsgeschichtlicher wie auch aufführungspraktischer und organologischer Zugänge gelegt. Ein erster Themenblock beschäftigt sich mit dem Zusammenhang von Klanggestalt und Ästhetik und versucht dabei, die Stellung der Orgel im musikalischen Denken und praktischen Musikleben der Romantik zu bestimmen. Während Arnfried Edler in seiner Robert Schumann gewidmeten Betrachtung die Bedeutung der Orgel für einen der großen Komponisten und Musikpublizisten der Zeit rekonstruiert, widmet sich Burkhard Meischein dem Einfluss veränderter liturgischer und theologischer Anschauungen auf das zeitgenössische Verständnis vom angemessenen Orgelklang. Kristian Wegscheider identifiziert in den Instrumenten von Carl August Buchholz ein noch immer wenig bekanntes, dabei jedoch gerade für die Orgelmusik der Generation Mendelssohns typisches Klangideal, wobei anhand des von Buchholz vorgenommenen Umbaus der Stellwagenorgel in St. Marien zu Stralsund zugleich frühe Restaurierungskonzepte vorgestellt werden – die Frage des Historismus erhält hier also eine organologische Dimension. Vier Beiträge widmen sich einzelnen Strängen, Problemen und Paradigmen der Orgelkomposition nach Bach. Uwe Wolf stellt mit seinem kommentierten Katalog der choralgebundenen Orgelwerke von Gottfried August Homilius das Schaffen eines der einflussreichsten Komponisten der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zur Diskussion. Jean-Claude Zehnder widmet sich im Spannungsfeld von Philosophie, Ästhetik und Spieltechnik rhythmischen Problemen der Orgelmusik zwischen 1700 und 1900. Peter Wollny charakterisiert in seiner Beschäftigung mit der Orgelmusik Felix Mendelssohn Bartholdys dessen Bach-Rezeption als Resultat einer umfassenden Werkkenntnis und gattungsübergreifenden Synthese von Anregungen, die weit über den Einbau und die Übernahme einzelner Zitate und Modelle hinausreicht. Rudolf Lutz demonstriert anhand seiner Vervollständigung von Mendelssohns Oxforder Choralfragment „O Haupt voll Blut und Wunden“ die noch immer unterschätzten Potentiale einer improvisationsbasierten Annäherung an Mendelssohns organistische Tonsprache. Mendelssohns praktischer Erfahrungshorizont als Organist und Bach-Spieler sowie seine Bedeutung für die Orgelwelt seiner Zeit ist Schwerpunkt einer dritten Gruppe von Aufsätzen. Nicholas Thistlethwaite gibt in seinem Beitrag einen Überblick über die englischen Orgeln der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und arbeitet damit sowohl die genaueren Umstände von Mendelssohns Orgeldarbietungen in England als auch dessen nachhaltigen Einfluss auf die Weiterentwicklung des englischen Orgelbaus heraus. Wm. A. Little untersucht in seiner Fallstudie zu Mendelssohns Orgelrecitals in Birmingham 1837 und 1840 einen bisher wenig bekannten Teil von Mendelssohns englischen Konzertreisen. Markus Zepf legt eine von Mendelssohns eigenen Orgelentdeckungen inspirierte Untersuchung der Instrumententypen und der im Wandel befindlichen organistischen Klangideale im süddeutschen Raum vor. Russell Stinson geht unter Bezugnahme auf das berühmte Leipziger Orgelkonzert vom August 1840 der Ausstrahlung von Mendelssohns Bach-Spiel auf die Repertoirebildung und Bach-Rezeption der Organisten seiner Zeit nach. Wichtige Teilbereiche und Facetten der organistischen Berufspraxis im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert werden in einem weiteren Teil des Bandes zum Teil erstmals einer eingehenden Untersuchung unterzogen. Michael Maul widmet sich anhand von zeitgenössischen Archivalien und Traktaten den Anforderungsprofilen an Organisten in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und stellt damit Material für eine realistischere Beurteilung des Leistungsvermögens dieses Berufsstandes in der Epoche nach Bach bereit. Anselm Hartinger geht anhand von Konzertprogrammen und Presserezensionen dem Erscheinungsbild, den Protagonisten und der Transformation der Aufführungsgattung „Orgelkonzert“ im 19. Jahrhundert nach und untersucht dabei den Einfluss Bachscher Kompositionen sowie klassischer organistischer Gattungen und Techniken auf die Herausbildung eines neuzeitlichen Repertoirekanons im Bereich der Orgel. Annegret Rosenmüller setzt sich mit der schulebildenden Tätigkeit Carl Ferdinand Beckers sowie dem Niveau und den Schwerpunkten der Orgelausbildung am 1843 gegründeten „Conservatorium der Musik“ in Leipzig auseinander. Christoph Kaufmann beschäftigt sich anhand der Parameter „Artikulation“ und „Pedalapplikatur“ mit spieltechnischen Grundlagen und der Rolle veröffentlichter Schulwerke für das Orgelspiel nach 1800. Aspekte der Bach-Aneignung und unterschiedliche Ansätze in der zeitgenössischen Editionspraxis von Orgelwerken werden in einem abschließenden Teil des Bandes betrachtet. Andreas Glöckner stellt einzelne „Bach-Organisten“ des frühen 19. Jahrhunderts und ihr Spielrepertoire vor. Christine Blanken widmet ihren Beitrag den Bemühungen des Wiener Verlegers Tobias Haslinger um die Herausgabe von Orgelmusik. Thomas Synofzik richtet sein Augenmerk auf Robert Schumanns Tätigkeit als Bach-Herausgeber und fragt nach der Motivation und den Auswahlgrundsätzen für die von Schumann der Neuen Zeitschrift für Musik beigelegten Musikbeispiele. Karen Lehmann betrachtet das Wirken des bedeutenden Erfurter Musikverlegers Gottfried Wilhelm Körner und geht der Bedeutung seiner Orgeleditionen und Fachperiodika vor allem für die mitteldeutsche Orgellandschaft nach. Die Beigabe einer Tonaufnahme des von Rudolf Lutz vollendeten Mendelssohnschen Choralfragments macht einen der interessantesten Erträge der im Zuge der Erarbeitung dieses Bandes angestellten Forschungen auch in klingender Form zugänglich. Zugleich möge sie für jene enge Verbindung von wissenschaftlicher Forschung und historisch reflektierter Praxis stehen, die das vorliegende Buchprojekt charakterisiert und die auch für die weitere Annäherung an die Musik Bachs, Mendelssohns und Schumanns fruchtbare Ergebnisse verspricht. Die Entstehung des vorliegenden Bandes wäre ohne die Unterstützung zahlreicher Personen und Institutionen nicht möglich gewesen. Zu danken ist zunächst den Autoren, die unsere Einladung annahmen und bereit waren, an diesem Buchprojekt mitzuwirken. Sodann gebührt besonderer Dank dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, dem Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst sowie der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die durch ihre Förderung die Vorbereitung und Realisierung von Symposion und Aufsatzsammlung ermöglichten. Die mit dem Bach- Archiv und dem Gemeinschaftprojekt verbundenen Leipziger Institutionen Mendelssohn- Haus, Schumann-Haus und Musikinstrumenten-Museum sowie das Institut für Musikwissenschaft der Universität leisteten wertvolle Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung des Symposions. Die Übersetzung der englischen Beiträge und die redaktionelle Bearbeitung lagen in den Händen von Stephanie Wollny. Manuel Bärwald überprüfte gewissenhaft sämtliche Zitate anhand der Quellentexte. Martina Heuer und Frank Litterscheid übernahmen Text- und Notensatz. Ihnen allen schulden wir herzlichen Dank. Ganz besonders sei schließlich auch dem Verlag Breitkopf & Härtel für die Unterstützung des Vorhabens und die Aufnahme des vorliegenden Buches in das Verlagsprogramm gedankt. Leipzig, im August 2010 1 AMZ 29, Nr. 21 (23. Mai 1827), Sp. 354f. (siehe auch Dok VI, D 135); Leipziger Tageblatt und Anzeiger, Nr. 118 (26. Oktober 1832).
Hr. Musikdirektor Bach spielte eine von ihm selbst (etwas zu klaviermässig) gesetzte Toccata und ein Präludium nebst Fuge von Sebastian Bach auf der Orgel mit grosser Fertigkeit. In Berlin ist es etwas seltenes, dies herrliche, imponirende Instrument einmal concertirend gebraucht zu hören.Schade nur, daß die Zahl derer, die sich für das erhabenste aller Instrumente interessiren, sich fast nur auf einen kleinern Cirkel von Kunstkennern beschränkt. [...] Vor Einförmigkeit hatte sich der Concertgeber theils durch die ihn unterstützenden Männerchöre, theils durch die Verschiedenartigkeit der von ihm vorgetragenen Stücke, gesichert.Die beiden einleitenden Zitate - das erste die Rezension eines unter Mitwirkung August Wilhelm Bachs im April 1827 in der Berliner Garnisonkirche gegebenen Benefizkonzerts, das zweite der Bericht über ein Orgelkonzert des Virtuosen Ferdinand Vogel am 21. Oktober 1832 in der Paulinerkirche zu Leipzig1 - beleuchten trotz ihrer Kürze wesentliche Potentiale und Probleme des Orgelspiels in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und deuten das aufführungspraktische und ästhetische Spannungsfeld an, in dem sich die Orgel in dieser Schlüsselperiode der Herausbildung des modernen Musiklebens befand. Einerseits mehr denn je als Ausdruck des "Erhabenen" angesehen und gerade in der Romantik von der Würde des Kirchenraums und dem Geheimnis des geistlichen Geschehens überstrahlt, sah sich die Orgel nach den in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts allenthalben bemerkbaren Transformationsprozessen in der kirchenmusikalischen Landschaft mit einem Bedeutungsverlust konfrontiert, der ihre Stellung im Musikleben ernsthaft gefährdete. Die Orgel blieb zwar als gottesdienstliches Begleitinstrument unangefochten, mit dem Ende des Generalbasszeitalters wurde sie jedoch vielerorts aus ihrer Leit- und Stützfunktion im Ensemble und damit aus der Normbesetzung von Figuralaufführungen und Oratoriendarbietungen verdrängt. Den aus der Sinfonik und Kammermusik der Zeit abgeleiteten Vorstellungen von einem dynamisch beweglichen und stufenlos farbigen Klang konnte die weithin als unflexibel oder gar "steinern" (Moritz Hauptmann) empfundene mechanische Pfeifenorgel kaum noch entsprechen. Neuartige liturgische Erwartungshaltungen und die vom Repertoire her gemischt zusammengesetzten Kirchenkonzerte ließen dem solistischen Orgelspiel überdies nur begrenzten Raum. Dazu fanden gerade ambitionierte Orgelvorträge regelmäßig nur das Interesse einer sehr begrenzten Zahl von Kennern und Kunstfreunden.Dieser veränderte Darbietungskontext und wohl auch ein verbreiteter Rückgang insbesondere der Pedaltechnik führten im Bereich der Orgelliteratur vielfach zu einem Verlust der idiomatischen Schreibweise und einer Angleichung an klaviergeprägte Klangideale und Spielgewohnheiten, was sich nicht nur in zahlreichen "leichten" Spielstücken, Bearbeitungen und Variationen ausdrückte, sondern auch an dem Umstand ablesen lässt, dass es sich bei einem Großteil der in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts an der Orgel dargebotenen Bach-Werke um Fugen aus dem Wohltemperierten Klavier handelte. Dennoch gehörten die Orgelmusik, der Organistenstand und der Orgelbau um und nach 1800 zu den Bereichen des Musiklebens, bei denen eine gewisse Kontinuität barocker Handwerks-, Gattungs-, Spiel- und Ausbildungstraditionen gegeben war. Vermittelt durch Schüler und Enkelschüler Bachs wie etwa Johann Christian Kittel und gestützt auf eine breite abschriftliche Verbreitung seiner Kompositionen blieben hier überdies Teile des orgelbezogenen Schaffens Bachs in einer Weise lebendig, die die lange Zeit gehegte Vorstellung einer raschen Abwendung von seiner Musik nach 1750 mehr und mehr fraglich erscheinen lässt. Welche Bedeutung die konstante Pflege Bachschen Repertoires und die nicht zuletzt mit der Tätigkeit Felix Mendelssohn Bartholdys verbundene Wiederaneignung zahlreicher Schlüsselwerke seines organistischen Oeuvres für die Entwicklung des Orgelspiels und der O
| Erscheint lt. Verlag | 5.7.2011 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Beiträge zur Geschichte der Bach-Rezeption ; 3 |
| Sprache | deutsch |
| Maße | 170 x 245 mm |
| Gewicht | 1005 g |
| Einbandart | gebunden |
| Themenwelt | Kunst / Musik / Theater ► Musik ► Allgemeines / Lexika |
| Schlagworte | Instrument • Mendelssohn • Mendelssohn Bartholdy, Felix • Orgel |
| ISBN-10 | 3-7651-0441-8 / 3765104418 |
| ISBN-13 | 978-3-7651-0441-1 / 9783765104411 |
| Zustand | Neuware |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
aus dem Bereich