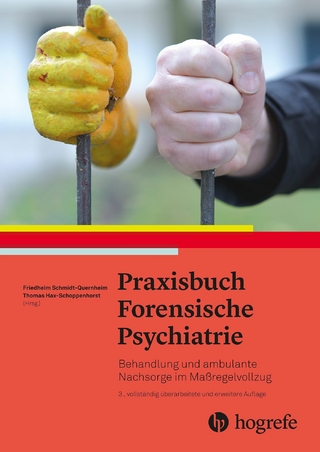Neurologie und Psychiatrie für Pflegeberufe (eBook)
520 Seiten
Georg Thieme Verlag KG
978-3-13-167911-6 (ISBN)
0 Vorwort zur 11. Auflage 6
0 Anschriften 8
1 Umgang mit dem Patienten 24
Begegnung mit Patienten 24
Bewusstlose Patienten 24
Schmerzpatienten 24
Patienten mit Anpassungsschwierigkeiten 24
Sterbende Patienten 24
Einbindung des Patienten in den Krankenhausalltag 25
Umgang mit Angehörigen 25
Anforderungen an das therapeutische Team 25
Begleitung von Patienten 25
2 Pflege in der Neurologie 27
Einführung 27
Pflegerische Behandlung in der Neurologie 27
Allgemeine Aspekte der pflegerischen Behandlung in der Neurologie 27
Spezielle Aspekte der pflegerischen Behandlung in der Neurologie 28
Pflege auf einer neurologischen Intensivstation 29
Bewusstlose Patienten 29
Pflegerische Tätigkeiten 30
Pflege in einer Stroke-Unit 30
Pflege in einer Rehabilitationsklinik 31
Was ist Rehabilitation? 31
Pflege in der Rehabilitation 31
Pflege in einer Rehabilitationseinrichtung am Beispiel der neurologischen Rehabilitation 34
Pflege in einer MS-Klinik 37
Besonderheiten einer MS-Klinik 37
Anforderungen an die Pflege 37
Pflege in einer Parkinson-Spezialklinik 39
Besonderheiten einer Parkinson-Spezialklinik 39
Anforderungen an die Pflege 40
3 Untersuchungsmethoden 42
Einführung 42
Vorgeschichte 42
Neurologische Untersuchung 42
Zusatzuntersuchungen 42
Vorgeschichte 42
Vorgehen bei der Anamneseerhebung 42
Krankheitsanamnese 43
Allgemeiner und interner Befund 43
Neurologische Untersuchung 43
Hirnnerven 44
Motorisches System 51
Reflexe 53
Sensibles System 57
Koordination 60
Sprache und andere neuropsychologische Leistungen 60
Vegetative Funktionen 62
Psychischer Befund 62
Bewusstsein 62
Neurologische Syndrome 63
Zusatzuntersuchungen in der Neurologie 64
Aufklärung und Einwilligung 65
Vorbereitung 65
Liquoruntersuchungen 65
Pflegeschwerpunkt: Lumbalpunktion (LP) 67
Vorbereitung 67
Durchführung 68
Nachsorge 70
Neuroradiologische Untersuchungen 71
Computertomografie (CT) 71
Kernspintomografie, Magnetresonanztomografie (MRT) 73
Kontrastmittelverfahren 75
Untersuchungen mit radioaktiven Isotopen 77
Elektrophysiologische Untersuchungen 77
Doppler-Sonografie 81
Biopsien 82
4 Krankheiten des Gehirns 86
Einführung 86
Durchblutungsstörungen des Gehirns 86
Tumoren des Gehirns und seiner Hüllen 86
Schädel-Hirn-Traumen 86
Infektiös-entzündliche Erkrankungen des Gehirns 86
Extrapyramidale Erkrankungen 86
Frühkindliche Hirnschäden 86
Durchblutungsstörungen des Gehirns 86
Anatomie und Physiologie 86
Durchblutungsstörungen des arteriellen Systems, Schlaganfall 88
Durchblutungsstörungen des venösen Systems 94
Therapie bei Durchblutungsstörungen des Gehirns 95
Pflegeschwerpunkt: Hemiplegie 96
Therapeutisch aktivierende Pflege nach dem Bobath-Konzept 97
Fundamente des Bobath-Konzepts 98
Auswirkungen auf den Patienten nach einem Schlaganfall 100
Sich bewegen können 103
Sich waschen und kleiden können 110
Kommunizieren können 112
Essen und Trinken können 112
Tumoren und andere raumfordernde Prozesse 113
Gutartige Tumoren 114
Bösartige Tumoren 116
Hirnmetastasen 116
Therapie bei raumfordernden intrakraniellen Prozessen 116
Pflegeschwerpunkt: Onkologische Erkrankungen des ZNS 117
Aufnahmesituation 117
Präoperative Situation 118
Postoperative Situation 118
Therapieformen 119
Prioritäten in der neuroonkologischen Pflege 120
Begleiterkrankungen 120
Notfallsituationen in der Betreuung neuroonkologischer Patienten 121
Nachsorge 121
Schädel-Hirn-Traumen 122
Schädelprellungen und -frakturen 122
Schädelverletzungen mit Hirnbeteiligung 123
Therapie bei traumatischen Schäden des Gehirns 127
Infektiös-entzündliche Erkrankungen 127
Eitrige Meningitiden 127
Nicht eitrige Meningitiden 129
Enzephalitiden 130
Hirnabszesse 132
Therapie bei Meningitiden und Enzephalitiden 132
Pflegeschwerpunkt: Meningitis 132
Unterstützung bei diagnostischen Maßnahmen 132
Überwachung 133
Pflegerische Maßnahmen in Abhängigkeit von psychischen und physischen Einschränkungen 134
Prophylaktische Maßnahmen 136
Besonderheiten bei Meningokokken-Meningitis 137
Extrapyramidale Erkrankungen (Bewegungsstörungen) 138
Parkinson-Syndrom 138
Pflegeschwerpunkt: Morbus Parkinson 140
Wichtiges Grundlagenwissen für den Umgang mit Parkinson-Patienten 140
Unterstützung bei der ATL „Umgebung gestalten“ 141
Unterstützung bei der ATL „Waschen und Kleiden“ 142
Unterstützung bei der ATL „Essen und Trinken“ 143
Unterstützung bei der ATL „Ausscheiden“ 144
Unterstützung bei der ATL „Sich bewegen“ 144
Unterstützung bei der ATL „Wach sein und schlafen“ 146
Unterstützung bei der medikamentösen Therapie 146
Chorea Huntington 147
Torticollis dystonicus, Torsionsdystonie und andere extrapyramidale Bewegungsstörungen 148
Frühkindliche Hirnschädigungen und Missbildungen des Gehirns 149
Missbildungen des Gehirns 149
Zerebrale Kinderlähmung 149
5 Krankheiten von Gehirn und Rückenmark 152
Einführung 152
Lues 152
Borreliose 152
Multiple Sklerose 152
Infektiös-entzündliche Erkrankungen 152
Poliomyelitis 152
Gürtelrose (Zoster) 153
Tetanus 154
Luische Erkrankungen des Nervensystems 155
Borreliosen 157
Multiple Sklerose (Encephalomyelitis disseminata) 158
Degenerative Erkrankungen von Gehirn und Rückenmark 161
Spinozerebellare Heredoataxien 161
Friedreich-Krankheit 161
Nonne-Marie-Krankheit 162
Olivopontozerebelläre Atrophien 162
Therapie der Heredoataxien 162
Pflegeschwerpunkt: Multiple Sklerose 162
Psychische Situation des kranken Menschen 162
Streckspastik, Multiple Sklerose 163
Beugespastik 165
Adduktorenspastik 166
Paresen 166
Ataxie 166
Gleichgewichtsstörungen 167
Unterstützung bei der ATL „Sich waschen und kleiden“ 167
Unterstützung bei der ATL „Essen und Trinken“ 168
Unterstützung bei der ATL „Ausscheiden“ 169
Unterstützung der ATL „Sich als Frau oder Mann fühlen“ 171
Unterstützung bei der ATL „Kommunizieren“ 171
Unterstützung bei der ATL „Ruhen und Schlafen“ 171
Medikamentöse Therapie bei MS 172
6 Krankheiten des Rückenmarks 174
Einführung 174
Querschnittlähmungen 174
Entzündungen und Systematrophien 174
Kreislaufbedingte Erkrankungen 175
Myelomalazien und vaskuläre Kaudasyndrome 175
Rückenmarks- und Kaudaschäden durch Gefäßmissbildungen 176
Raumfordernde spinale Prozesse 176
Spinale Tumoren 176
Entzündliche spinale Prozesse 179
Myelitis 179
Epiduralabszess 179
Traumatische und mechanische Schädigungen des Rückenmarks und der Kauda 180
Syndrom der Querschnittlähmung 181
Offene Schädigungen des Rückenmarks und der Kauda durch Schuss- und Stichverletzungen 183
Rückenmarksschäden bei Elektrounfällen 184
Therapie der traumatischen Rückenmarksschäden 184
Pflegeschwerpunkt: Querschnittlähmung 185
Sicherheit 186
Atmung 186
Kreislauf 188
Temperaturregulation 190
Haut 190
Mobilität 192
Ausscheidungen 195
Psychische Situation 197
Lernen und Beraten 197
Sexualität 198
Potenzielle Komplikationen 198
Degenerative und stoffwechselbedingte Erkrankungen 199
Syringomyelie und spinaler Gliastift 199
Degeneration des zentralen und peripheren motorischen Neurons (Motoneuron-Erkrankungen) 200
Funikuläre Spinalerkrankung 202
Fehlbildungen des Rückenmarks 202
7 Krankheiten der peripheren Nerven und der Muskeln 205
Einführung 205
Umschriebene Schädigungen 205
Polyneuropathien 205
Myopathien 205
Umschriebene Schädigungen des peripheren Nervensystems 205
Wurzelschädigungen 205
Plexusschäden 209
Umschriebene periphere Nervenschäden 211
Pflegeschwerpunkt: Wurzelschädigung bei Bandscheibenprolaps 215
Angepasste Lagerung 216
Physiotherapie 217
Medikamentöse Therapie 217
Unterstützung bei schmerzbedingten Einschränkungen 217
Operative Therapie 217
Postoperative Pflegemaßnahmen 217
Nachbehandlung 218
Polyneuropathien 218
Idiopathische Polyneuritis (Guillain-Barré-Syndrom [GBS]) 221
Myopathien und verwandte Prozesse 221
Muskeldystrophien 221
Seltene Muskelerkrankungen 222
Myasthenie 223
Polymyositis 225
8 Epilepsien und epileptische Anfälle 227
Einführung 227
Einteilung der Epilepsien 227
Nichtepileptische Anfallssyndrome 227
Pathophysiologie der Epilepsie 227
Anfallsarten (Einteilung der Anfälle) 228
Beschreibung der einzelnen Epilepsien 229
Lokalisationsbezogene (fokale) Epilepsien 229
Generalisierte Epilepsien 230
Epileptische Gelegenheitsanfälle 232
Altersgebundene Epilepsien 233
Seltene Anfallsformen 234
Ursachen der Epilepsie 235
Psychische Veränderungen im Rahmen der Epilepsie 235
Epileptischer Dämmerzustand 235
Epileptische (organische) Wesensveränderung 235
Demenz als Folge von Anfällen 236
Therapie und psychische Führung 236
Verhalten beim einzelnen Anfall 236
Therapie bei Häufung von Anfällen (Status epilepticus) 237
Dauerbehandlung 237
Pflegeschwerpunkt: Epilepsie 239
Pflegemaßnahmen während eines Anfalls 240
Unterstützung bei der medikamentösen Therapie 241
Unterstützung beim prolongierten Video-EEG-Monitoring 242
Pflegerische Unterstützung beim präoperativen Video-EEG-Monitoring 242
Postoperative Pflegemaßnahmen 244
Patienten- und Angehörigenedukation 244
Nichtepileptische Anfallssyndrome 245
Synkopen 245
Tetanie 245
Panikattacken 245
Narkolepsie 246
9 Neurologische Schmerzsyndrome 248
Einführung 248
Schmerzursachen 248
Schmerztherapie 248
Allgemeines 248
Ursachen und Einteilung 248
Schmerztherapie 250
Beschreibung einzelner Schmerzsyndrome 250
Kopfschmerzen 250
Gesichtsschmerzen 251
10 Psychische Störungen: Wesen, Ursachen, traditionelle und aktuelle Klassifikation 254
Einführung 254
Ursachen psychischer Störungen 254
Vulnerabilitäts-Stress-Modell 254
Klassifikationen psychischer Störungen 255
Traditionelle Klassifikation 255
Moderne Klassifikationssysteme 256
11 Diagnostik in der Psychiatrie 259
Einführung 259
Anamnese 259
Aktuelle Anamnese 259
Frühere psychiatrische Anamnese 259
Suchtanamnese 259
Vegetative Anamnese 259
Somatische Anamnese 259
Familienanamnese 259
Biografische Anamnese 259
Fremdanamnese 260
Psychischer Befund 260
Bewusstsein 260
Kognition 261
Orientierung 262
Formaler Gedankengang 262
Inhaltliche Denkstörungen 263
Wahrnehmungsstörungen 264
Ich-Störungen 265
Affekt 265
Angstphänomene 266
Zwangsphänomene 266
Antrieb und Psychomotorik 266
Motivationslage und Willensäußerungen 267
Soziales Verhalten 267
Eigen- oder Fremdgefährdung 267
Hinweise auf die Persönlichkeit 267
Körperlicher Befund 268
Pflegeanamnese, Verhaltens- und Verlaufsbeobachtung in der psychiatrischen Pflege 268
Überwachung und Beurteilung von körperlichen und psychischen Basiswerten 268
Pflegeanamnese 269
Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit 269
Zusatzuntersuchungen 270
Testpsychologische Diagnostik 270
Laboruntersuchungen 271
Apparative Zusatzdiagnostik 271
12 Therapie in der Psychiatrie 273
Grundzüge der Therapie 273
Multidimensionale Therapie 273
Integrativer Ansatz 273
Aufklärung, Empowerment 274
Therapeutisches Bündnis, Adherence, Einbeziehung der Familie 274
Patientenautonomie vs. Zwang 274
Evidenzbasierte Medizin (EbM), Leitlinien 275
Biologische Behandlungsmethoden 275
Pharmakotherapie 275
Aufgaben der Pflege bei der Pharmakotherapie 289
Weitere biologische Behandlungsmethoden 289
Psychotherapie 290
Psychoanalyse/tiefenpsychologische Psychotherapie 291
Verhaltenstherapie 293
Gesprächspsychotherapie/klientenzentrierte Psychotherapie 297
Weitere Psychotherapieverfahren 297
Entspannungsverfahren 298
Kognitive Remediation/Training basaler kognitiver Funktionen 304
Besondere Psychotherapieformate 304
Schulenübergreifende, störungsorientierte Psychotherapie 305
Bewegungs- und Sporttherapie 306
Begriffsbestimmung 306
Ziele der Bewegungs- und Sporttherapie 307
Das Salutogenesekonzept nach Aaron Antonovsky 308
Zusammenhang des Kohärenzgefühls zur Bewegungs- und Sporttherapie 309
Ergotherapie und Rehabilitation 311
Ergotherapie im psychiatrischen Krankenhaus 311
Medizinische Rehabilitation 314
Berufliche Rehabilitation oder Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 314
Ergotherapie in freier Praxis 315
Abschließende Betrachtungen 315
Soziotherapie und Rehabilitation 316
Historische Entwicklung 317
Begriffsbestimmung 317
Entwicklungsperspektiven der Soziotherapie 318
Die rechtliche Stellung der Soziotherapie 319
Von der Anstalt in die Gemeinde 319
Komplementäre Einrichtungen und Case Management 319
Das Vorgehen bei der Rehabilitation psychisch kranker Menschen 320
Integrierte Hilfeplanung – der personenzentrierte Ansatz 320
Pflege in der Psychiatrie 322
Vom Irrenwärter zur modernen psychiatrischen Pflege 322
Struktur, Aufbau und personelle Ausstattung einer Psychiatrischen Klinik 323
Organisation und Instrumente der Pflege 324
Aufgaben in der Pflege 326
Anforderungen, Grenzen und Gefahren für die Pflegenden 328
Umgang mit Gewalt und Aggression/Entstehung und Vermeidung von Gewalt in der Psychiatrie 329
13 Notfälle, Suizidalität, Krisenintervention 333
Einführung 333
Vigilanzminderung 333
Verwirrtheit/Delir 333
Erregungszustände 334
Stupor 335
Suizidalität/Krisenintervention 335
Pflegeschwerpunkt: Behandlung suizidaler Patienten 336
Auslöser 337
Erkennen von Suizidalität 337
Umgang mit Suizidalität 337
14 Ethische und rechtliche Aspekte 340
Einführung 340
Einwilligungsfähigkeit 340
Betreuungsrecht 340
Antragsstellung 340
Betreuende Person 341
Unfreiwillige Unterbringung und Behandlung in einem psychiatrischen Krankenhaus 341
Unterbringung und Behandlung nach dem Betreuungsgesetz (BTG) 341
Unterbringung und Behandlung nach den Unterbringungsgesetzen der Bundesländer (Psych-KG) 341
Schuldfähigkeit und psychiatrische Maßregeln 342
Maßregelvollzug 342
Unterbringung in einer Entziehungsanstalt 342
Sicherungsverwahrung 342
Verhandlungs- und Haftfähigkeit 343
Geschäftsfähigkeit und Testierfähigkeit 343
15 Psychosen aus dem schizophrenen Formenkreis 346
Schizophrenie 346
Geschichte 346
Psychopathologische Symptome 346
Formen und Verläufe 352
Häufigkeit, Ursachen, begleitende Befunde 354
Begleitbefunde und Differenzialdiagnose 356
Therapie 357
Pflegeschwerpunkt: Pflege bei der Behandlung von Patienten mit Schizophrenie 359
Kontaktaufnahme und Beziehungsgestaltung 359
Interventionen bei der Betreuung von Menschen mit wahnhaftem Erleben 361
Andere Störungsformen 362
Wahnhafte Störungen 362
Akute polymorphe psychotische Störung 363
Akute schizophreniforme Störung 363
Schizotype Störung 363
Psychosen im Wochenbett 363
Schizoaffektive Störungen 364
Sonstige Psychosen 364
16 Affektive Störungen 366
Einführung 366
Psychopathologische Symptome 366
Depression 366
Manie 367
Formen und Verläufe 367
Nosologische Einteilung 368
Einteilung nach der ICD-10-Klassifikation 369
Häufigkeit und Ursachen 370
Neurobiologische Faktoren 370
Chronobiologische Veränderungen 370
Belastende Lebensereignisse 370
Lerntheoretische Aspekte 371
Therapie 371
Medikamentöse Behandlung 371
Weitere biologische Behandlungsmethoden 374
Psychotherapie 374
Bewegungs- und Sporttherapie bei Patienten mit Depression 376
Pflegeschwerpunkt: Pflege bei der Behandlung von Patienten mit Depression 377
Pflegeschwerpunkt: Die Rolle der Pflege bei der Durchführung der Schlafentzugstherapie 379
Pflegeschwerpunkt: Die Rolle der Pflege bei der Durchführung der Elektrokrampftherapie 379
17 Organische psychische Störungen 381
Einführung 381
Akute organische psychische Störungen 381
Delir 381
Andere akute organische psychische Störungen 382
Chronische organische psychische Störungen 383
Demenzen 383
Andere chronische organische psychische Störungen 389
Pflegeschwerpunkt: Umgang mit dementen Menschen 390
Die neue Welt 390
Einfühlsamer Umgang mit einem Dementen 391
Einstellen auf die veränderte Lebenssituation 391
Ausschöpfen der Erinnerungsfähigkeit 391
Bewusste Pflege des Langzeitgedächtnisses 391
Neugestaltung des Umfelds 392
Orientierungshilfen in Flur oder Gang 392
Einrichtung des eigenen Zimmers 393
Dementengerechte Bauten 393
Schmückende Orientierungshilfen im Wohnbereich 395
Geborgenheit fördernde Umgebung 395
Altbauten, kleine Heime 395
Große „junge“ Altbauten 396
Flure optisch unterbrechen 396
Beleuchtung 397
Verbindungsgänge, Handläufe 397
Gestaltung der Eingangsbereiche 398
Mit Dekorationen das Langzeitgedächtnis aktivieren 399
Schaufenster und Schaukästen dekorieren 399
Orientierung über die Sinne ermöglichen 399
Pflegerische Interventionen in besonderen Situationen 401
Exkurs Gerontopsychiatrie 405
18 Störungen durch psychotrope Substanzen 407
Definitionen und Ursachen 407
Bedingungsgefüge der Suchtentstehung 407
Alkoholismus 409
Häufigkeit, Symptome, Klassifikationen 409
Psychiatrische Folgeerkrankungen 410
Therapie 413
Abhängigkeit von Medikamenten 414
Benzodiazepine 414
Weitere Medikamente mit Abhängigkeitspotenzial 415
Störungen durch illegale Drogen 416
Störungen durch Opiate 416
Störungen durch Kokain 418
Störungen durch Amphetamine 419
Störungen durch Cannabis 420
Störungen durch Halluzinogene 421
LSD-ähnliche Halluzinogene 421
„Atypische“ Halluzinogene 422
Ecstasy (MDMA) 422
Polytoxikomanie (polyvalente Sucht) 422
19 Neurotische Störungen 424
Angststörungen 424
Spezifische Phobie 424
Soziale Phobie 425
Agoraphobie 426
Panikstörung 426
Generalisierte Angststörung 428
Komorbidität von Angststörungen mit anderen psychischen Störungen 428
Pflegeschwerpunkt: Behandlung von Angstpatienten 428
Herantreten an den angsterfüllten Menschen 428
Begleitung bei speziellen Therapieformen 430
Zwangsstörungen 431
Behandlung von Zwangspatienten 432
Vorbereitung des Patienten 432
Reduzierung und Unterdrückung der Zwangshandlung 433
Konversionsstörungen (Dissoziative Störungen) 433
Sonstige neurotische Störungen 435
Neurasthenie 435
Depersonalisations-/Derealisationssyndrom 435
20 Somatoforme Störungen 437
Einführung 437
Formen der somatoformen Störungen 437
Somatisierungsstörung 437
Somatoforme autonome Funktionsstörung 437
Somatoforme Schmerzstörung 438
Hypochondrische Störung 438
Bewegungs- und Sporttherapie bei Patienten mit somatoformen Störungen 438
21 Reaktionen auf schwere Belastungen 441
Einführung 441
Akute Belastungsreaktion 441
Anpassungsstörung 442
Persönlichkeitsveränderung nach Extrembelastung 443
Posttraumatische Belastungsstörung 443
22 Persönlichkeitsstörungen 446
Definition, Unterformen 446
Paranoide Persönlichkeitsstörung 446
Schizoide Persönlichkeitsstörung 447
Dissoziale Persönlichkeitsstörung 447
Emotional instabile Persönlichkeitsstörung 447
Histrionische Persönlichkeitsstörung 448
Anankastische (zwanghafte) Persönlichkeitsstörung 449
Ängstliche (vermeidende) Persönlichkeitsstörung 449
Dependente (abhängige) Persönlichkeitsstörung 450
Weitere Persönlichkeitsstörungen 450
Prävalenz und Ursachen 450
Allgemeines 450
Genese der Borderline-Persönlichkeitsstörung 451
Therapie 452
Psychotherapie 452
Psychopharmakotherapie 453
Pflegeschwerpunkt: Behandlung von Borderline-Patienten 454
Grundannahmen 454
Verträge und Vereinbarungen 456
Verhaltensanalyse 457
Bezugspflegesystem 458
Notfallkarten und Notfallkoffer 458
Achtsamkeit 461
Spannungskurve 461
Wochenprotokoll 461
Aufgaben des therapeutischen Teams 463
Wertzeitkalender 463
23 Abnorme Gewohnheiten, Störungen der Impulskontrolle und sonstige Verhaltensstörungen 466
Abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle 466
Pathologisches Glücksspiel 466
Pathologische Brandstiftung und pathologisches Stehlen 466
Sonstige Verhaltensstörungen 466
Entwicklung körperlicher Symptome aus psychischen Gründen 466
Artifizielle Störung 466
24 Essstörungen 469
Einführung 469
Formen 469
Anorexie 469
Bulimie 471
Binge-Eating-Störung 471
Therapie der Essstörungen 471
Psychotherapie 471
Psychopharmakotherapie 472
Bewegungs- und Sporttherapie bei Patienten mit Essstörungen 472
25 Schlafstörungen 475
Einführung 475
Nichtorganische Insomnie 475
Weitere nichtorganische Schlafstörungen 476
Hypersomnie 476
Störung des Schlaf-wach-Rhythmus 476
Schlafwandeln 476
Pavor nocturnus 476
Albträume 476
26 Störungen der Sexualität und Geschlechtsidentität 478
Einführung 478
Nichtorganische sexuelle Funktionsstörungen 478
Störungen der Geschlechtsidentität 478
Störung der GI des Kindesalters 479
Transsexualismus 479
Störungen der Sexualpräferenz (Paraphilien, sexuelle Deviationen, Perversionen) 480
Psychische und Verhaltensstörungen in Verbindung mit der sexuellen Entwicklung und Orientierung 481
Sexuelle Reifungskrise 481
Ichdystone Sexualorientierung 481
Sexuelle Beziehungsstörung 481
27 Intelligenzminderung 483
Allgemeine Grundlagen 483
Klassifikation 483
Einteilung nach dem Grad der Intelligenzminderung 484
Einteilung nach dem Grad der Lernbeeinträchtigung 484
Spezielle Krankheitsformen 485
Chromosomenanomalien mit möglicher Intelligenzminderung 485
Oligophrenie bei einer angeborenen oder früh erworbenen Unterfunktion der Schilddrüse 485
Therapie/Förderung 486
Förderung und Psychotherapie 486
Medikamentöse Therapie 486
28 Störungen mit Beginn im Kindes- oder Jugendalter 488
Einführung 488
Tief greifende Entwicklungsstörungen 488
Frühkindlicher Autismus 488
Asperger-Syndrom 489
Hyperkinetische Störungen und Störungen des Sozialverhaltens 489
Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung (ADHS) 489
Störungen des Sozialverhaltens 490
Tic-Störungen 491
Gilles de la Tourette-Syndrom 491
Weitere Störungen des Kindesalters 491
Emotionale Störung mit Trennungsangst 491
Elektiver Mutismus 492
Enuresis 492
Enkopresis 492
29 Anhang 495
Kontakt- und Internetadressen 495
Literatur 497
30 Sachverzeichnis 502
Foto: Alexander Fischer, Thieme |
1 Umgang mit dem Patienten
Walter F. Haupt
1.1 Begegnung mit Patienten
Wie in jedem medizinischen Fach ist auch in der Neurologie die Kontaktaufnahme zwischen den Mitgliedern des therapeutischen Teams und den Patienten von entscheidender Bedeutung. Ärzte und Pflegende erfassen gleich zu Beginn des Klinikaufenthalts bei einem Anamnesegespräch wichtige Daten, v. a. zur Symptomatik und zum sozialen Umfeld des Patienten ( ▶ Abb. 1.1). In der Neurologie gibt es allerdings einige spezielle Konstellationen, in denen diese Begegnung besonderer Kenntnisse und Fähigkeiten bedarf:
Kontaktaufnahme.
Abb. 1.1 Die Begrüßung auf Station ist die erste Gelegenheit, um Näheres über den Patienten zu erfahren.
(Foto: Alexander Fischer, Thieme)
1.1.1 Bewusstlose Patienten
Eine besondere Herausforderung ist die Betreuung und Versorgung bewusstloser Patienten, deren Reaktionsfähigkeit aufgehoben ist. Um die diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen trotzdem rasch treffen zu können, müssen die erforderlichen Informationen daher von Begleitpersonen erfragt werden.
1.1.2 Schmerzpatienten
Patienten, die über starke Schmerzen klagen sind oft schwierig zu beurteilen und angemessen zu behandeln. In dieser Situation sind die Betrachtungen der Mitglieder des therapeutischen Teams für die behandelnden Ärzte essentiell. Informationen von Patienten und Angehörigen zu Art und Ausdehnung der Schmerzen müssen immer ernst genommen und möglichst genau an das behandelnde Ärzteteam weitergeleitet werden.
Nur so kann genau geklärt werden, um welche Art von ▶ Schmerz es sich handelt:
-
typischer Leitungsschmerz,
-
übertragener Schmerz aus dem Bereich innerer Organe,
-
Rezeptorenschmerz als wichtiges Alarmsymptom einer akuten Erkrankung.
Bei chronischen Schmerzzuständen ohne erkennbare Organlokalisation muss eine korrekte diagnostische Zuordnung erfolgen, bevor an rein psychogene oder simulierte Schmerzzustände gedacht wird. Bei chronischen Schmerzzuständen kann häufig keine vollständige Schmerzfreiheit erreicht werden, der Patient soll jedoch dazu befähigt werden, bestmöglich mit seinen Schmerzen im Alltag leben zu können. Die Angehörigen und das soziale Umfeld des Patienten werden in diesem Fall mit in die Therapie einbezogen.
1.1.3 Patienten mit Anpassungsschwierigkeiten
Für viele Patienten ist die Situation im Krankenhaus neu. Einige fühlen sich unwohl und können sich nur schwer an das ungewohnte Umfeld anpassen. Das ist normal. Haben Patienten darüber hinaus jedoch besonders ausgeprägte Schwierigkeiten bei der Anpassung, sollte dies diagnostisch abgeklärt werden.
-
Handelt es sich um eine hirnorganisch bedingte Orientierungsstörung oder Aggressivität, muss der Arzt entscheiden, ob die Medikation umgestellt oder z. B. Psychopharmaka nötig sind, um dem Patient zu helfen.
-
Handelt es sich dagegen nicht um eine hirnorganisch bedingte Funktionsstörung, sondern lediglich um einen Patienten mit geringer Anpassungsbereitschaft, muss im gemeinsamen Gespräch nach einer Lösung gesucht werden.
1.1.4 Sterbende Patienten
Die Behandlung und Begleitung von Patienten mit ungünstiger Prognose ist für alle Beteiligten eine besondere Herausforderung.
Pflege
Gestaltung der Umgebung. Eine wichtige Aufgabe der Pflegenden im Rahmen der Betreuung Sterbender besteht darin, eine ruhige und würdige Umgebung zu gestalten, in der sich die Patienten geborgen und mit ihren Nöten angenommen fühlen.
In den meisten Krankenhäusern ist die Raumgestaltung eher funktional und nur wenig auf die Bedürfnisse sterbender Patienten ausgerichtet. Hospize hingegen sind auf diese Situation spezialisiert. Die palliative Schmerztherapie sowie die angenehme, meist familiäre Umgebung ermöglichen den Patienten ein würdevolles Sterben im Kreise ihrer Angehörigen.
Liegt ein Patient im Krankenhaus im Sterben, sollte er ein Einzelzimmer erhalten. So kann er sich in Ruhe von seinen Angehörigen verabschieden und vom therapeutischen Team in dieser letzten Phase begleitet werden. Bestehen Schmerzen, müssen diese gelindert werden.
1.2 Einbindung des Patienten in den Krankenhausalltag
Patienten mit neurologischen Krankheiten kommen in allen Altersgruppen vor. Besonders häufig ereignen sich Unfallschäden im jüngeren und mittleren Lebensalter. Ältere Menschen hingegen leiden eher unter Durchblutungsstörungen und degenerativen Erkrankungen.
Müssen Patienten ihre gewohnte Umgebung verlassen, kann dies eine schwere Belastung für sie sein. Ganz besonders schwierig ist dies für Kinder, ältere Personen oder Menschen mit Demenz.
Die hohe Belastung wirkt sich aus auf:
-
die Stimmung,
-
den Appetit,
-
den Schlaf,
-
die mitmenschlichen Kontakte.
Die hilfsbereite und verständnisvolle Einführung in Stationserfordernisse, den Tagesablauf und die geplanten diagnostischen und therapeutischen Verfahren, gibt vielen Patienten Sicherheit ( ▶ Abb. 1.2). Bei komplizierten Abläufen sind schriftliche Erinnerungshilfen sinnvoll.
Information.
Abb. 1.2 Eine umfassende Information, wie hier z. B. über die Rufanlage, ist wichtig, damit der Patient sich in der neuen Umgebung sicher fühlt.
(Foto: Alexander Fischer, Thieme)
Die Pflegenden stellen in der Regel die Brücke zwischen den bisherigen Rahmenbedingungen in der Familie und der Welt des Krankenhauses her. Oft werden Sorgen und Nöte im Beisein der Pflegekräfte, weniger während der ärztlichen Visite geäußert.
1.3 Umgang mit Angehörigen
Der Umgang mit besorgten Angehörigen verlangt viel Taktgefühl und Einfühlungsvermögen des therapeutischen Teams. Oft reagieren Angehörige in Notfallsituationen scheinbar unangemessen, werden laut oder aggressiv. Eine ruhige und sachliche Haltung kann die Situation meist entschärfen.
1.4 Anforderungen an das therapeutische Team
Die Betreuung der Patienten mit Erkrankungen des Nervensystems erfordert vom therapeutischen Team:
-
umfangreiche Fachkenntnisse über die neurologischen Krankheitsbilder,
-
Verantwortungsbereitschaft und
-
großen Einsatz.
Außerdem muss bei allen Mitarbeitern die Fähigkeit zur Kooperation und Kommunikation mit den anderen Berufsgruppen vorhanden sein.
Das therapeutische Team besteht aus:
-
Ärzten,
-
Pflegenden,
-
Physiotherapeuten,
-
Laborpersonal,
-
Beschäftigungstherapeuten,
-
Logopäden,
-
Sozialarbeitern u. a.
Die allgemeine und spezielle neurologische Behandlung muss von allen an der Pflege, Therapie und Diagnostik beteiligten Berufsgruppen konsequent geplant, dokumentiert und zielgerichtet durchgeführt werden. Eine gemeinsame Zielplanung und regelmäßige Absprachen im Team sind wichtig, um den therapeutischen Erfolg zu sichern. Die Qualitätsentwicklung wird so erleichtert.
1.4.1 Begleitung von Patienten
Die Begleitung von Patienten mit neurologischen Erkrankungen ist Aufgabe des gesamten therapeutischen Teams. Nur wenn die Patienten gut informiert sind, können sie auch aktiv am Behandlungsprozess mitwirken. In der Neurologie sind Heilerfolge nicht immer mit einer vollständigen Genesung verbunden. Das therapeutische Team wird demnach häufig konfrontiert mit:
-
schweren Behinderungen,
-
psychischen Veränderungen,
-
gestörten Hirnfunktionen,
-
längeren Liege- und Verweilzeiten.
Die Patienten müssen vom therapeutischen Team über ihre Erkrankung aufgeklärt und informiert werden (Patientenedukation). Oft bleiben eine Halbseitenlähmung, eine...
| Erscheint lt. Verlag | 27.4.2016 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Krankheitslehre |
| Verlagsort | Stuttgart |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Pflege ► Fachpflege ► Neurologie / Psychiatrie |
| Schlagworte | Altenpflege • Angststörungen • Bewusstsein • Demenz • Depression • Doppler-Sonographie • DOPPLER-SONOGRAPHI E • Elektrophysiologische Untersuchungen • Epilepsie • Gehirnerkrankungen • Generalistik • generalistische Pflegeausbildung • Gesundheits- und Krankenpflege • Kinderkrankenpflege • Krankenpfllege • Krankheitslehre • Lähmungen • Lehrbuch • Liquor • Multiple Sklerose • Neurologie • Neurologische Erkrankungen • Neuroradiologie • Parkinson • Parkinson-Kranke • Pflege • Pflegeausbildung • Psychiatrie • Psychiatrische Erkrankungen • Psychische Erkrankungen • Querschnittslähmung • reflexe • Rehabilitationsklinik • Rückenmarkserkrankungen • Schlaganfall • Sensibilität • Stroke-Unik • Stroke-Unit • Suizid • Tumoren • Untersuchungsmethoden |
| ISBN-10 | 3-13-167911-5 / 3131679115 |
| ISBN-13 | 978-3-13-167911-6 / 9783131679116 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 21,8 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
Größe: 23,4 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich