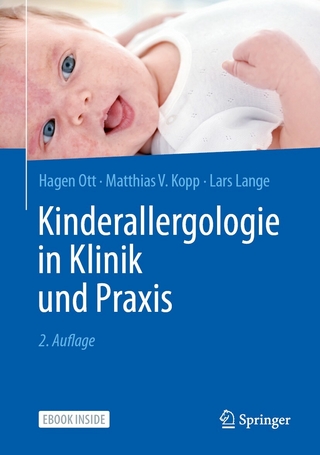Psychoneuroimmunologie und Psychotherapie (eBook)
492 Seiten
Schattauer (Verlag)
978-3-608-26823-2 (ISBN)
Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. M. Sc. Christian Schubert, Arzt, Psychologe, Psychotherapeut. Leiter des Labors für Psychoneuroimmunologie an der Klinik für Medizinische Psychologie der Medizinischen Universität Innsbruck. Leiter der Arbeitsgruppe 'Psychoneuroimmunologie' des Deutschen Kollegiums für Psychosomatische Medizin (DKPM). Vorstandsmitglied der Thure von Uexküll-Akademie für Integrierte Medizin (AIM). Arbeitsschwerpunkte: Entwicklung eines integrativen Ansatzes zur Erforschung psychosomatischer Komplexität, kombinierter Einsatz von qualitativen Methoden und Zeitreihenanalyse in der Psychoneuroimmunologie; Medizinphilosophie; Systemtheorie; Psychodynamische Psychotherapie.
Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. M. Sc. Christian Schubert, Arzt, Psychologe, Psychotherapeut. Leiter des Labors für Psychoneuroimmunologie an der Klinik für Medizinische Psychologie der Medizinischen Universität Innsbruck. Leiter der Arbeitsgruppe "Psychoneuroimmunologie" des Deutschen Kollegiums für Psychosomatische Medizin (DKPM). Vorstandsmitglied der Thure von Uexküll-Akademie für Integrierte Medizin (AIM). Arbeitsschwerpunkte: Entwicklung eines integrativen Ansatzes zur Erforschung psychosomatischer Komplexität, kombinierter Einsatz von qualitativen Methoden und Zeitreihenanalyse in der Psychoneuroimmunologie; Medizinphilosophie; Systemtheorie; Psychodynamische Psychotherapie.
Cover 1
Impressum 5
Geleitwort zur 2. Auflage 6
Geleitworte zur 1. Auflage 8
Vorwort zur 2. Auflage 10
Anschriften der Autoren 12
Inhalt 16
Einführung 22
Definitionen der Psychoneuroimmunologie 23
Problemgeschichte der Psychoneuroimmunologie 24
Neuroimmunologische Konstrukte der Vernetzung 24
Psychoneuroimmunologie und Immunoneuropsychologie 25
Paradigmatische Grenzen von »Psychoneuroimmunologie« und »Psychotherapie« 28
Aufbau des Buches und inhaltliche Übersicht 32
Abschließende Bemerkungen 36
Grundlagen 40
1 Psychotherapie und Gehirnaktivität 42
1.1 Einleitung 42
1.2 Neuronale Netzwerke und Psychotherapie 44
1.2.1 Psychotherapie und Depression 44
1.2.2 Kognitive Verhaltenstherapie bei Zwangserkrankungen 46
1.2.3 Kognitive Verhaltenstherapie bei Panikerkrankungen 47
1.2.4 Kognitive Verhaltenstherapie bei sozialer Phobie und Spinnenphobie 47
1.2.5 Kognitive Verhaltenstherapie bei Posttraumatischer Belastungsstörung 49
1.2.6 Weitere psychologische Interventionen 49
1.2.7 Zusammenfassung 51
1.3 Effekte der Psychotherapie auf Hirnregionen mit Verbindung zu immunologisch-endokrinologischen Funktionen 52
2 Neuroendokrinologie und Psychoneuroimmunologie 56
2.1 Einleitung 56
2.2 Wechselwirkungen zwischen Hormon- und Immunsystem 56
2.3 Hormone der Hypophyse und das Immunsystem 58
2.4 Hormonresistenz 60
2.5 Zirkadiane Rhythmik 62
2.6 Stressforschung 63
2.7 Auswirkungen erhöhter Cortisol- und Catecholaminwerte auf das Immunsystem 64
2.8 Zukünftige Forschungsrichtungen der Neuroendokrinologie und PNI 65
3 Immunologische Grundlagen der Psychoneuroimmunologie 71
3.1 Einleitung 71
3.2 Evolution des Immunsystems 75
3.3 Angeborenes Immunsystem 76
3.4 Erworbenes Immunsystem 78
3.4.1 Zellen des erworbenen Immunsystems 78
3.4.2 Aktivierung des erworbenen Immunsystems 80
3.5 Regulation der Immunantwort 83
3.6 Entzündung 84
3.7 Messung der Immunaktivität in der PNI 85
3.8 Ausblick: Epigenetik und PNI 86
3.9 Immunologie und PNI 87
4 Psychoneuroimmunologie körperlicher Erkrankungen 89
4.1 Einleitung 89
4.2 PNI der Erkrankungen mit TH1-Suppression 90
4.2.1 Wundheilung 92
4.2.2 Viruserkrankungen 94
4.3 PNI der Entzündungskrankheiten 102
4.3.1 Atopie und Allergie 105
4.3.2 Autoimmunkrankheiten 108
4.4 PNI und Krebs 110
4.5 Sickness behavior und immunologisch vermittelte Depression 120
4.6 Schlussfolgerung und kritischer Ausblick 127
5 Einfluss von frühen psychischen Belastungen auf die Entwicklung von Entzündungserkrankungen im Erwachsenenalter 138
5.1 Einleitung 138
5.2 HPA-Achse und immunologische Stressreaktion 138
5.3 Adverse-Childhood-Experiences ACE)-Studie 139
5.4 Entwicklung und Entwicklungsstörung der HPA-Achse 140
5.5 Gestörte Entwicklung des Immunsystems und Krankheitsfolgen 143
5.5.1 Allergisches Asthma bronchiale 143
5.5.2 Autoimmunerkrankungen 149
5.6 Wirksamkeit von frühen Interventionen auf die Stresssystemaktivität psychisch belasteter Kinder 153
5.7 Psychosomatische Psychotherapieforschung – eine Utopie? 154
6 Negativfaktoren, Immunaktivität und Psychotherapie 162
6.1 Einleitung 162
6.2 PNI und emotionale Probleme infolge von Stress 162
6.2.1 Auswirkungen von Stress auf das Immunsystem 163
6.2.2 Fazit 168
6.3 PNI und Depression 169
6.3.1 Depression und Parameter des Immunsystems 169
6.3.2 Mögliche Moderatoren zwischen Depression und Immunität 172
6.4 PNI und Angst 174
6.5 PNI und interindividuelle Unterschiede 176
6.5.1 Neurotizismus, negative Affektivität und Feindseligkeit 176
6.5.2 Bindungsstil 179
6.5.3 Repressiver Stil und Alexithymie 180
6.5.4 Soziale Hemmung 181
6.5.5 Coping 181
6.6 Schlussfolgerung 182
7 Positivfaktoren, Immunaktivität und Psychotherapie 189
7.1 Einleitung 189
7.2 PNI und Positivfaktoren 189
7.3 Optimismus 190
7.3.1 Optimismus und Immunaktivität 191
7.3.2 Optimismus und Psychotherapie 195
7.4 Attributionsstil 196
7.4.1 Attributionsstil und Immunaktivität 197
7.4.2 Attributionsstil und Psychotherapie 197
7.5 Selbstwert 198
7.5.1 Selbstwert und Immunaktivität 198
7.5.2 Selbstwert und Psychotherapie 199
7.6 Selbstwirksamkeit 200
7.6.1 Selbstwirksamkeit und Immunaktivität 200
7.6.2 Selbstwirksamkeit und Psychotherapie 201
7.7 Posttraumatisches Wachstum und benefit finding 201
7.7.1 Posttraumatisches Wachstum/benefit finding und Immunaktivität 202
7.7.2 Posttraumatisches Wachstum/benefit finding und Psychotherapie 203
7.8 Positiver Affekt 204
7.8.1 Positiver Affekt und Immunaktivität 205
7.8.2 Positiver Affekt und Psychotherapie 208
7.9 Soziale Beziehungen 208
7.9.1 Soziale Beziehungen und Immunaktivität 209
7.9.2 Soziale Beziehungen und Psychotherapie 210
7.10 Positivfaktoren, Immunaktivität und Psychotherapie 211
7.11 Immunaktivität und Gesundheit 212
7.12 Schlussfolgerung 212
Experimentelle Aspekte 220
8 Konditionierung des Immunsystems 222
8.1 Einleitung 222
8.2 Grundlagen 223
8.2.1 Bidirektionale Kommunikation zwischen Nerven- und Immunsystem 223
8.2.2 Bestandteile des Immunsystems 224
8.3 Lernmechanismen 225
8.3.1 Einteilung der Lernvorgänge 225
8.3.2 Klassische Konditionierung 226
8.3.3 Instrumentelle Konditionierung 228
8.4 Konditionierte Immunaktivität – Grundlagen 228
8.4.1 Basisexperiment von Ader und Cohen und die Folgestudien 228
8.4.2 Klassisch konditionierbare Reaktionen des Immunsystems – eine Übersicht 230
8.5 Konditionierte Immunaktivität – klinische Anwendung 237
8.5.1 Übersicht 237
8.5.2 Autoimmunerkrankungen 237
8.5.3 Allergien 240
8.5.4 Infektionen und Heroin 241
8.5.5 Abstoßungsreaktionen bei Organtransplantationen 242
8.5.6 Krebs 243
8.6 Instrumentelle Konditionierung – gelernte Hilflosigkeit und Immunparameter 251
8.7 Mediierung klassisch konditionierter Immunmodulation 253
8.7.1 Kommunikationswege 254
8.7.2 Neuroanatomische Korrelate 254
8.7.3 Intrazelluläre Mechanismen 257
8.7.4 Klassische Konditionierung in vitro? 257
8.7.5 Extinktionslernen 258
8.8 Perspektiven für die Grundlagenforschung und klinische Anwendung 259
8.9 Fazit 260
9 Expressives Schreiben und Immunaktivität – gesundheitsfördernde Aspekte der Selbstöffnung 266
9.1 Einleitung 266
9.2 Das Paradigma des Expressiven Schreibens 267
9.3 Wirksamkeit des Expressiven Schreibens 268
9.3.1 Allgemeine Wirksamkeit 268
9.3.2 Moderatorvariablen: Aspekte der Durchführung 269
9.3.3 Differenzielle Wirksamkeit 270
9.3.4 Expressives Schreiben und Immunaktivität 271
9.4 Erklärungsmodelle zur Wirksamkeit des Expressiven Schreibens 274
9.4.1 Inhibitionstheorie 275
9.4.2 Habituationstheorie 275
9.4.3 Kognitiv-linguistische Verarbeitungstheorie 275
9.4.4 Selbstregulationstheorie 276
9.4.5 Soziale-Integrations-Theorie 276
9.4.6 Empirische Hinweise auf psychophysiologische Wirkmechanismen 277
9.5 Möglichkeiten und Grenzen des Expressiven Schreibens in Psychotherapie und Psychosomatik 279
9.6 Zusammenfassung und Ausblick 281
10 Hypnose, Imagination, Selbstregulierung und Immunaktivität 286
10.1 Einleitung 286
10.2 Frühe klinische Studien zur Hypnose und Immunaktivität 287
10.3 Hypnose bei Kindern 288
10.4 Hypnose und Imagination bei Kindern mit Fokussierung auf Immunparameter 289
10.5 Hypnose und Imagination bei Immunerkrankungen von Kindern 293
10.6 Hypnose bei Erwachsenen 295
10.7 Direkte Suggestion mit Fokussierung auf Immunparameter bei Erwachsenen 295
10.8 Entspannungstraining mit oder ohne Imagination bei Erwachsenen 299
10.9 Hypnose und Imagination bei Erwachsenen mit Fokus auf Immunerkrankungen 301
10.10 Fazit 301
11 Endokrine und immunologische Wirkungen von Musik 306
11.1 Einleitung 306
11.2 Musiktherapeutische Anwendungen 307
11.3 Musik als psychoaktiver Stimulus 308
11.4 Neuroendokrine Marker 310
11.4.1 Cortisol 310
11.4.2 Oxytocin 311
11.4.3 Testosteron 312
11.4.4 Beta-Endorphine 312
11.4.5 Weitere neurochemische Marker 313
11.5 Immunologische Marker 313
11.5.1 Sekretorisches Immunoglobulin A 313
11.5.2 Weitere Immunmarker 314
11.6 Ausblick 315
11.7 Fazit 316
Klinische Aspekte 322
12 Einfluss von Stressmanagement auf Elemente des Immunsystems 324
12.1 Einleitung 324
12.1.1 Methoden des Stressmanagements 324
12.1.2 Wirkung von Stressmanagement auf immunologische Faktoren 325
12.2 Interventionen bei HIV-Infektion 327
12.2.1 Studien ohne Verbesserung der Immunfunktion 327
12.2.2 Studien mit Verbesserung der Immunfunktion 329
12.2.3 Metaanalysen 336
12.3 Interventionen bei Krebs 337
12.3.1 Malignes Melanom 337
12.3.2 Brustkrebs 338
12.3.3 Prostatakrebs 341
12.4 Intervention bei Colitis ulcerosa 341
12.5 Fazit 342
13 Die Psychoneuroimmunologie der Achtsamkeit 347
13.1 Einleitung 347
13.2 Studienauswahl 349
13.3 Immuneffekte achtsamkeitsbasierter Interventionen 350
13.3.1 Krebspatienten 350
13.3.2 HIV-Patienten 353
13.3.3 Gesunde Erwachsene 355
13.3.4 Zusammenfassung bisheriger Untersuchungen 359
13.4 Fazit 361
14 Psychoneuroimmunologie und Gesprächstherapie/psychodynamische Therapie 364
14.1 Einleitung 364
14.2 Objektivierung von Gesprächstherapie/psychodynamischer Therapie mit bildgebenden Verfahren 366
14.3 Objektivierung von Gesprächstherapie/psychodynamischer Therapie mit Markern der PNI 369
14.3.1 Konventionelle Gruppenstudien 369
14.3.2 Einzelfallstudien 371
14.4 Fazit 378
Thematische und methodische Besonderheiten des Forschungsbereichs 382
15 Bedeutungs-volle Krankheit, Psychoneuroimmunologie und der Mind-Body-Arzt 384
15.1 Einleitung 384
15.2 Phänomenologie bedeutungs-voller Erkrankungen im klinischen Kontakt 386
15.2.1 Fallstudie: Patientin mit rheumatoider Arthritis 386
15.2.2 Fallstudie: Patient mit Dermatitis 388
15.2.3 Klassifikation bedeutungs-voller Erkrankungen 388
15.3 PNI und das Problem der somatischen Metapher 389
15.4 Multiple Codierungstheorie 392
15.5 Verankerung der PNI und der symbolischen Erkrankungen 394
15.6 Der fehlende »Sprung« von der Psyche zum Körper 395
15.7 Der Mind-Body-Arzt 399
16 Dynamik und Komplexität der Immunantwort – ein nichtlinearer Ansatz 402
16.1 Einleitung 402
16.2 Verhalten des Modells der Immunantwort 405
16.3 Modellerweiterungen 411
16.3.1 Kontinuierlicher Targeteinstrom 411
16.3.2 Impfmodelle 412
16.4 Abschließende Bemerkungen 414
Literatur 415
17 Der psychotherapeutische Prozess – Einblicke in die Selbstorganisation bio-psycho-sozialer Systeme 416
17.1 Der psychotherapeutische Prozess – eine Black Box? 416
17.1.1 Die Datenbasis 416
17.1.2 Theorien und Modelle 421
17.1.3 Biologische Marker des Therapieprozesses 423
17.2 Empirische Anomalien und das Modell der Selbstorganisation 425
17.3 Neurobiologische Korrelate therapeutischer Ordnungsübergänge 430
18 Soziopsychoneuroimmunologie – Integration von Dynamik und subjektiver Bedeutung in die Psychoneuroimmunologie 439
18.1 Einleitung 439
18.2 Bio-psycho-soziale Forschung 440
18.2.1 Subjektive Bedeutung im BPS-Modell 441
18.2.2 Dynamik im BPS-Modell 444
18.2.3 Subjektive Bedeutung und Dynamik in der BPS-Forschung – eine Synthese 446
18.3 Biomedizinisches Paradigma und dessen Erkenntnisgrenzen 450
18.4 Beispiele für den Erkenntnisgewinn durch Beziehungsforschung 452
18.4.1 Design der »integrativen Einzelfallstudien« 452
18.4.2 Verlaufscharakteristika des Stressreaktions-Prozesses im Alltag 454
18.4.3 Chronische Erschöpfung bei Brustkrebs als Ausdruck eines gestörten Stresssystems – klinische Relevanz integrativer Einzelfallstudien 459
18.5 Schlussbemerkung 464
Literatur 466
Danksagung 466
Sachverzeichnis 474
| Erscheint lt. Verlag | 1.1.2018 |
|---|---|
| Vorwort | Horst Kächele, Joel E. Dimsdale, Gerhard Schüßler |
| Verlagsort | Stuttgart |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Medizin / Pharmazie ► Medizinische Fachgebiete ► Innere Medizin |
| Medizin / Pharmazie ► Medizinische Fachgebiete ► Neurologie | |
| Medizin / Pharmazie ► Medizinische Fachgebiete ► Pädiatrie | |
| Medizin / Pharmazie ► Medizinische Fachgebiete ► Psychosomatik | |
| Medizin / Pharmazie ► Medizinische Fachgebiete ► Psychiatrie / Psychotherapie | |
| Studium ► Querschnittsbereiche ► Infektiologie / Immunologie | |
| Schlagworte | Achtsamkeit • ACTH • Altersmedizin • Antibiotikatherapie • Antigen • Antigene • Autoimmunerkrankungen • Balneotherapie • BDNF • Bio-psycho-sozial • Cancer • Chemokine • Chirurgie • Cortison • CTA • Diagnose • Diagnostik • Elektroenzephalografie • Endokrinologie • Entspannungstraining • Entspannungsverfahren • Entzündungserkrankungen • Erkrankungen • Facharzt • Gesprächstherapie • HAART • HBV • HIV • Hypertonie • Hypnose • Imagination • Immunaktivität • Immunologie • Immunologie und HIV • Immunologie und Krebs • immunology • Immunsystem • Immunzellen • Infektion • Infektionskrankheiten • Intensivmedizin • Internist • Konditionierung • Körper-Psyche-Wechselwirkungen • Krebsbehandlung • Limbisches System • Lipide • Mammakarzinom • menopause • MHC • Mind-Body-Konzept • Musiktherapie • Nebenniere • Nervensystem • Neuroendokrinologie • Neurologie • neurologische • Neuronale Netzwerke • Pathophysiologie • Psychodynamische Psychotherapie • Psychoimmunologie • Psychoneuroimmunologie • Psychoneuroimmunology • Psychotherapie • Schmerztherapie • Selbstregulation • Selbstwirksamkeit • SLE • Soziopsychoneuroimmunologie • SPECT • Stressmanagement • Stressmedizin • Thrombose • TNF • Tumoren • VAS • vasculitis • VEGF • Zentralnervensystem • Zirkadiane Rhythmik • ZNS |
| ISBN-10 | 3-608-26823-5 / 3608268235 |
| ISBN-13 | 978-3-608-26823-2 / 9783608268232 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 5,0 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich