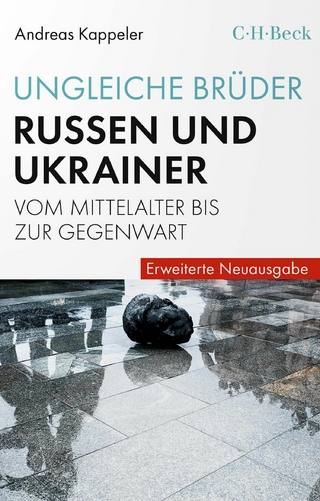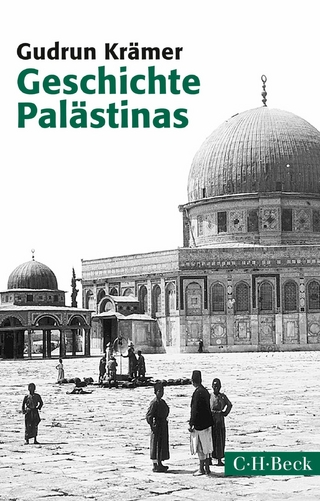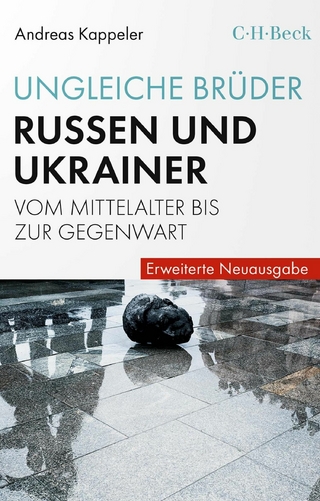Z (eBook)
224 Seiten
Rowohlt Verlag GmbH
978-3-644-01648-4 (ISBN)
Olaf Kühl, 1955 geboren, studierte Slawistik, Osteuropäische Geschichte und Zeitgeschichte und arbeitete lange Jahre als Osteuropareferent für die Regierenden Bürgermeister von Berlin. Er ist Autor und einer der wichtigsten Übersetzer aus dem Polnischen und Russischen, u.a. wurde er mit dem Karl-Dedecius-Preis und dem Brücke Berlin-Preis ausgezeichnet. Sein zweiter Roman, «Der wahre Sohn», war 2013 für den Deutschen Buchpreis nominiert.
Olaf Kühl, 1955 geboren, studierte Slawistik, Osteuropäische Geschichte und Zeitgeschichte, arbeitete von 1995 bis 2021 als Osteuropareferent für die Regierenden Bürgermeister von Berlin. Er ist ein exzellenter Kenner Russlands und der Region. Kühl, der als Schriftsteller mehrere Romane vorlegte – «Der wahre Sohn» war für den Deutschen Buchpreis nominiert –, zählt zudem zu den wichtigsten Übersetzern aus dem Polnischen und Russischen und wurde unter anderem mit dem Karl-Dedecius-Preis und dem Brücke Berlin-Preis ausgezeichnet.
Der Traum von alter Größe
Drei Jahre nach meinem Amtsantritt in der Berliner Senatskanzlei brach die Sowjetunion auseinander. Am 8. Dezember 1991 unterzeichneten Russlands Präsident Boris Jelzin, der ukrainische Präsident Leonid Krawtschuk und der Vorsitzende des Obersten Sowjets von Belarus und ex officio Staatsoberhaupt, Stanislaw Schuschkewitsch, die «Belowescher Vereinbarung» über die Gründung der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS). Damit besiegelten sie den Zerfall der Union, der sich schon vorher in zahlreichen Souveränitätserklärungen einzelner Republiken manifestiert hatte.
Die deutsche Öffentlichkeit schenkte dem inneren Hergang dieses Zerfalls keine besondere Aufmerksamkeit, zu hingerissen war sie vom Jubel über die von Gorbatschow ermöglichte Wiedervereinigung. Am 12. Februar 1990 teilte der sowjetische Botschafter in Ostberlin, Wjatscheslaw Kotschemassow, dem Regierenden Bürgermeister Walter Momper im Senatsgästehaus Moskaus prinzipielle Zustimmung zur Wiedervereinigung mit. Der Untergang des sowjetischen Imperiums wurde von einigen als Sieg des Westens im Kalten Krieg verstanden, andere verführte er sogar zu der Illusion eines «Endes der Geschichte». Heute zeigt sich, wie irrig diese Vorstellung war.
Eröffnete der Zusammenbruch für manche – nicht nur im Westen – die berauschenden Möglichkeiten einer Tabula rasa, eines historischen Neuanfangs, so erzeugte er bei anderen tiefe Verletzungen und Ängste. Das bewiesen die zahlreichen Briefe russischer Kriegsveteranen, von denen Dutzende in der Senatskanzlei eingingen. Kriegsveteranen – das sind jene ganz mit bunten Orden und Auszeichnungen behängten alten Menschen, deren Anzahl in den letzten Jahren subjektiv eher noch zugenommen hat. Objektiv müsste diese Generation allmählich ausgestorben sein. Denn wer 1945 mit achtzehn Jahren in der Roten Armee gekämpft hat, ist heute fünfundneunzig. Um diesen Mangel wettzumachen, werden bei Gedenkfeiern auch sichtlich jüngere Personen in ähnlicher Aufmachung in die Stuhlreihen gesetzt, schon kleine Kinder in Uniformen der Roten Armee gekleidet und auf Spielzeugpanzern platziert. Oder man trägt Fotos der Großväter und anderer Vorfahren bei Umzügen vor sich her – in der Aktion «Unsterbliches Regiment».
In den neunziger Jahren klagten diese Veteranen dem Regierenden Bürgermeister von Berlin, damals Eberhard Diepgen, ihr Leid. Im Vordergrund stand dabei gar nicht die Bitte um materielle Unterstützung. Eher wirkte es so, als wollten sie ihr Herz ausschütten. Unter den Absendern waren viele Frauen, auch eine Kampfpilotin. Eine in Abwandlungen häufige Wendung lautete: «Wenn es heute so ist, dass ich mir nicht einmal Brot leisten kann, dann wäre ich schon lieber im Krieg gegen Nazideutschland gefallen.» Was sollte man diesen Menschen antworten? Da Berlin materiell nicht allen helfen konnte, mussten Worte des Trostes hohl klingen. Wie soll der Besiegte den Sieger trösten?
Damals erstaunte es mich nicht, dass die sowjetischen Kriegsveteranen sich mit ihren Sorgen ausgerechnet an den Regierenden Bürgermeister von Berlin wandten. Er war formal nur Ministerpräsident eines deutschen Landes. Aber Berlin umwehte noch das Odium der alten Reichshauptstadt. Von hier aus hatten die Nazis ihre Menschheitsverbrechen geplant und dirigiert. Berlin war Metropole jenes Reiches, das die Sowjetunion und die Alliierten nur unter größten Opfern hatten niederringen können. Berlins Ansehen verdankte sich auch dem Status während der deutschen Teilung – aus Sicht des Ostens war der Westen der Stadt eine «selbstständige» politische Einheit. Viel hing von der persönlichen Statur des Amtsinhabers ab, von seiner Bereitschaft, dem entgegengebrachten internationalen Respekt gerecht zu werden. Nach den langen Amtszeiten von Eberhard Diepgen und Klaus Wowereit schnurrte die Bedeutung des Regierenden rasch zur Rolle eines «gewöhnlichen» Ministerpräsidenten zusammen. Von dieser Gestalt erwartete sich niemand mehr größeren Einfluss oder auch nur ein kluges Wort im Bereich der internationalen Beziehungen.
Damals rührten mich die Briefe der Veteranen. Im Rückblick muss es dennoch verwundern, welchen Adressaten die Schreiber sich ausgesucht hatten und was sie sich von ihren Briefen erhofften. War es nicht so, dass diese Menschen, enttäuscht von ihrem eigenen «Zaren» Boris Jelzin, sich nun an das Oberhaupt einer ausländischen Macht wandten – und dann noch ausgerechnet derjenigen, die sie selbst 1945 besiegt hatten? Kam in diesen Bitten nicht die Erwartung von Menschen zum Ausdruck, die seit Jahrzehnten daran gewöhnt waren, von ihrem Staat abhängig zu sein? Folgsam sein und alles geben, wenn er mich dafür ernährt, mir eine Wohnung gibt, und sei es auch nur ein Zimmer in der Kommunalka – der von mehreren Parteien geteilten Mietwohnung; der Staat nimmt mir Freiheit und Verantwortung ab, gibt mir das Denken vor. Im Rückblick erscheinen mir diese Klagebriefe ein frappierender Ausdruck jener Mentalität zu sein, die die Bolschewiki bei ihren Bürgern herangezüchtet haben – die Haltung des vom Staat existenziell Abhängigen. Freiheit und Verantwortung waren ihnen im Laufe von Generationen abtrainiert worden.
Das waren Briefe von Menschen, die ihr Leben lang alles von ihrem «Besitzer» erwartet hatten, wie Leibeigene von ihrem «Barin», dem Gutsherrn. Auch die Perestroika war ja nicht ihre Initiative, keine spontane Massenbewegung gewesen, sie war von oben dekretiert. Die Mentalität der Leibeigenen wirkte über ihre rechtliche Abschaffung in Russland hinaus. Das war 1861, fünfzig Jahre später als im übrigen Europa und in den Ostseegouvernements unter dem deutschbaltischen Adel. Die «befreiten» Bauern, die nicht selten in eine verschärfte wirtschaftliche Abhängigkeit ohne den alten Rechtsschutz gerieten, wurden schon 1917 zum Manipulationsobjekt neuer Herren. Lenin erklärte Grund und Boden zum Volkseigentum: Es gehöre demjenigen, der es bearbeite. Aber schon Ende der Zwanziger begann mit der Zwangskollektivierung die erneute Entmündigung. Das andere ideologische Vorzeichen half den Betroffenen nicht. «Die Klasse der Kleinproduzenten und Kleinbauern ist eine reaktionäre Klasse», hatte Lenin schon 1920 geschrieben. Als der Philosoph Bertrand Russell Lenin bei einem Besuch in Russland 1920 fragte, ob er statt der Sozialisierung des Landes nicht eher eine Klasse von besitzenden Bauern aufbaue, antwortete der: «Sehen Sie, es gibt arme Bauern und reiche Bauern, und wir haben die armen gegen die reichen Bauern aufgehetzt, und sie haben sie bald an den nächsten Baum gehängt, ah hah hah HAH HAH.»
Die Bauern flohen vor der Kollektivierung massenhaft in die Städte. Um diese Migration zu kontrollieren, stellte die Sowjetregierung im Januar 1933 zum ersten Mal «Binnenpässe» aus. Anspruch darauf hatten jedoch nur Arbeiter in den Städten, Staatsangestellte und andere privilegierte Gruppen ab sechzehn Jahren. Die meisten Bauern waren quasi an den Kolchos gefesselt, «befestigt», wie das in der Etymologie des russischen Wortes für Leibeigene («крепостной») zum Ausdruck kommt. Weiter als ins Bezirkszentrum durften sie nicht reisen. Eine willkommene Nebenwirkung des Passgesetzes war, dass Städte wie Leningrad und Moskau von unerwünschten «Elementen» gesäubert werden konnten. Vom Dorf geflohene enteignete «Kulaken» – die «soziale Herkunft» war im Pass vermerkt – bekamen keine Papiere. Ein eigens gegründetes Amt machte Jagd auf Personen, die sich vor der Erfassung versteckten. Erst unter Breschnew wurden ab 1976 Pässe für alle über Sechzehnjährigen ausgestellt. Solchermaßen von ihrer Fesselung an den Ort «befreit», mental aber immer noch geprägt von Jahrhunderten der Leibeigenschaft, wurden sie dann in die Wirren der postsowjetischen Zeit entlassen.
Kriegsveteranen werden an Feiertagen hofiert. Am 9. Mai – dem «Tag des Sieges» – genießen sie die größte Aufmerksamkeit. In der übrigen Zeit des Jahres müssen sie für die ihnen gesetzlich zustehenden Rechte, für Wohnung und Rente kämpfen, oft vergeblich. Das galt erst recht für die Soldaten, die in den achtziger und neunziger Jahren aus Afghanistan und Tschetschenien heimkehrten. Ihre Traumatisierung und Gewalterfahrung trugen zur Verrohung des Klimas in der russischen Gesellschaft bei. Drogensucht und häusliche Gewalt nahmen zu. Armee und KGB beteiligten sich am Heroinschmuggel aus Afghanistan. Die Heimkehrer blieben sich selbst überlassen. Ich finde hierfür keine passendere Beschreibung als den Satz aus dem Film «The Quest for Vengeance»: «Coming home is the one thing they never trained you for», die Heimkehr war das Einzige, für das sie nicht ausgebildet waren. Aus den gewalterfahrenen Afghanistankämpfern und Tschetschenienveteranen rekrutierten sich Mitglieder krimineller Banden. Literarisch ist diese Erfahrung unter anderem von der ukrainischen, Russisch schreibenden Theaterautorin Ganna Jablonska (Anna Jablonskaja) verarbeitet worden. Sie starb 2011 mit neunundzwanzig Jahren bei einem Sprengstoffanschlag auf dem Flughafen Domodedowo, als sie in Moskau einen Literaturpreis in Empfang nehmen wollte. Die Verantwortung für den Anschlag übernahm der Tschetschenenführer Doku Umarow.
Armut lässt sich ertragen, wenn man sie durch das Bewusstsein – wenigstens die Illusion – eigener Bedeutung kompensieren kann. Wenn man sich als – und sei es ein noch so winziges – Glied einer Großmacht fühlen kann, die Deutschland besiegt hat und die ihr Selbstbewusstsein auch siebzig Jahre später noch aus...
| Erscheint lt. Verlag | 14.3.2023 |
|---|---|
| Verlagsort | Hamburg |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Regional- / Landesgeschichte |
| Naturwissenschaften ► Geowissenschaften ► Geografie / Kartografie | |
| Schlagworte | Ferner Osten • Glasnost • Kapitalismus • Kaukasus • Kommunismus • Kreml • Ländergeschichte • Länderporträt • Moskau • Orthodoxe Kirche • Perestroika • Politisches Sachbuch • Putin • Rubel • Russische Seele • Russland • Sankt Petersburg • Schocktherapie • Sibirien • Sowjetunion • Tschetschenien • Ukraine • Ukrainekrieg • Ural • Zarenreich • Zeitgeschichte |
| ISBN-10 | 3-644-01648-8 / 3644016488 |
| ISBN-13 | 978-3-644-01648-4 / 9783644016484 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 3,0 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich