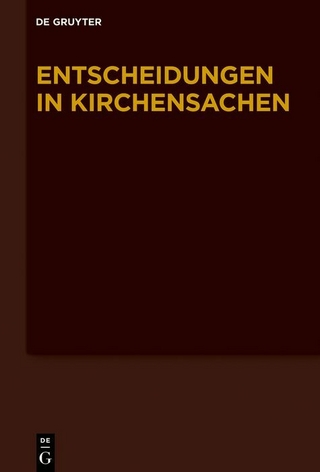Grundgesetz (eBook)
400 Seiten
Nomos Verlag
978-3-8452-7919-0 (ISBN)
Cover 1
1. Die Verfassung der Bürger: Grundlagen 18
1.1 Wie funktioniert Recht? - der klassische Ansatz 18
1.2 Wie funktioniert Recht? - der Beitrag der Bürger 20
1.3 Was leistet das Recht? 21
1.4 Was sagt Ihnen der Text des Grundgesetzes 23
1.5 Freiheit, staatliche Ordnung, Gemeinwohl 25
1.6 Wer sind die Bürger? 29
1.6.1 Die Bürger als Staatsvolk 29
1.6.2 Die Bürger als Träger von Rechten und Pflichten 31
1.7 An wen richtet sich die Verfassung? 32
1.8 Verfassungswerte 35
1.9 Welchen Wert messen Sie dem Grundgesetz bei? 36
1.10 Der Preis der Freiheit 39
1.11 Grenzen der Verfassung: Die Kompetenzen der Länder und Europas 42
1.11.1 Föderalismus: Kompetenzen der Länder 42
1.11.2 Europa: Kompetenzen der Europäischen Union 43
1.12 Verfassung und Politik 44
1.13 Meinungsstreit, aber kein Bürgerkrieg der Weltanschauungen 46
1.14 Das Grundgesetz braucht Auslegung 47
1.15 Kritische Nähe statt Staatsverdrossenheit 50
1.16 Von den allgemeinen Grundlagen zu den konkreten Themenfeldern des Grundgesetzes 51
1.17 Texte zur Vertiefung 52
2. Vor dem Gesetz: Rechtssicherheit und Gleichheit 54
2.1 Der Verfassungstext 54
2.2 Die Leitideen 55
2.2.1 Steuerung durch Recht: Nicht nur Gesetzesstaat, sondern Bindung an die Grundrechte 56
2.2.2 Vorrang der Verfassung 57
2.2.3 „Ewigkeitsgarantie“ 58
2.2.4 Friedensfunktion: Das staatliche Gewaltmonopol und der Schutz der Bürger 59
2.2.5 Gewaltenteilung 59
2.2.6 Vorbehalt des Gesetzes: Kein Eingriff in Rechte der Bürger ohne gesetzliche Grundlage 60
2.2.7 Transparenz 61
2.2.8 Bestimmtheit, Rückwirkungsverbot und Vertrauensschutz 61
2.2.9 Gleiches Recht für alle 62
2.2.10 Verfassungsgrundsatz der Verhältnismäßigkeit der Mittel 63
2.2.11 Rechtsschutz 64
2.3 Die Verfassungswirklichkeit 64
2.3.1 Überforderung des Rechtsstaates 64
2.3.2 Zu viel des Guten: Überregulierung, symbolische Gesetzgebung und Expertendeutsch 65
2.3.3 Abnehmende Steuerungskraft des Gesetzes, Verwischung von Staat und Gesellschaft 67
2.3.4 Die Macht unsichtbarer Gewalten 68
2.3.5 Schutz oder Freiheit 69
2.4 Praktische Bedeutung für die Bürger 70
2.4.1 Die Leistung des Rechtsstaates: Rechtssicherheit und Freiheit 70
2.4.2 Der Preis des Rechtsstaates: Die Bürgerpflicht zur Beachtung des Rechts 72
2.4.3 Das Grundrecht auf Gleichheit vor dem Gesetz 73
2.5 Häufig gestellte Fragen 74
2.6 Texte zur Vertiefung 78
3. Der Schutz der Person und ihrer Privatsphäre 79
3.1 Verfassungstext 79
3.2 Die Leitideen 82
3.2.1 Freiheit vor staatlichen Eingriffen 82
3.2.2 Menschenwürdegarantie 84
3.2.3 Schutz des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit 86
3.2.4 Das Recht auf Freiheit der Person im engeren Sinn (Art. 2 Abs. 2 S. 2 GG, Art. 104 GG) 87
3.2.5 Die Freizügigkeit (Art. 11 GG) 90
3.2.6 Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 GG) 91
3.2.7 Der Schutz von Ehe und Familie (Art. 6 GG) 93
3.2.7.1 Schutz von Ehe und Familie (Absatz 1) als Abwehrrecht 93
3.2.7.2 Elternrecht (Absätze 2 und 3) als Abwehrrecht 94
3.2.7.3 Art. 6 GG als Leistungsrecht 94
3.2.7.4 Art. 6 GG als Institutsgarantie 95
3.2.8 Das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis (Art. 10 GG) 95
3.2.9 Allgemeine Handlungsfreiheit 96
3.2.10 Das Sozialstaatsprinzip und der grundrechtliche Anspruch auf ein Existenzminimum 101
3.3 Die Verfassungswirklichkeit 103
3.3.1 Keine absolute Freiheit 103
3.3.2 Neue Fragen 104
3.3.2.1 Privatsphäre und technischer Fortschritt 104
3.3.2.2 Menschenwürde und technischer Fortschritt 109
3.3.2.3 Abwehr gegen gesellschaftliche und private Mächte? 115
3.3.2.4 Gesellschaftlicher Wandel der familiären Strukturen 120
3.4 Häufig gestellte Fragen 121
3.5 Texte zur Vertiefung 128
3.5.1 Allgemeines 128
3.5.2 Zur Diskussion um die Opferung Unschuldiger 129
3.5.3 Zum Folterverbot 129
3.5.4 Zum Datenschutz 130
4. Entfaltung in Gesellschaft und Wirtschaft 131
4.1 Der Verfassungstext 131
4.2 Die Leitideen 132
4.2.1 Die Mutter aller Grundrechte: Allgemeine Handlungsfreiheit, Art. 2 Abs. 1 GG 132
4.2.2 Beschränkungen: gesetzlich geordnete Handlungsfreiheit 134
4.2.3 Entfaltung in Gemeinschaft mit anderen: Vereinigungsfreiheit, Art. 9 GG 136
4.2.4 Entfaltung im Wirtschaftsleben: Berufsfreiheit, Art. 12 GG 137
4.2.5 Grenzen der Berufsfreiheit 138
4.2.6 Die wirtschaftliche Basis der Freiheit: Eigentum und Erbrecht, Art. 14 GG 140
4.2.7 Grundelemente der Wirtschaftsverfassung des Grundgesetzes 142
4.3 Die Verfassungswirklichkeit 143
4.4 Praktische Bedeutung für die Bürger 144
4.5 Häufig gestellte Fragen 146
4.6 Texte zur Vertiefung 149
5. Kommunikation und politische Teilhabe 150
5.1 Der Verfassungstext 150
5.2 Die Leitideen 151
5.2.1 Politische Teilhabe – Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus 151
5.2.1.1 Nur Wahlen 152
5.2.1.1.1 Der Abgeordnete als Repräsentant des Bürgers 154
5.2.1.1.2 Wahlrechtsgrundsätze und Wahlsystem 155
5.2.1.1.3 Das freie Mandat 156
5.2.1.1.4 Parteien 157
5.2.1.2 Legitimation staatlicher Entscheidungen 159
5.2.2 Kommunikationsfreiheit 161
5.2.2.1 Schutz der Kommunikation 161
5.2.2.2 Grenzen 164
5.2.2.3 Versammlungsfreiheit 165
5.2.2.4 Die Funktion der Versammlungsfreiheit in der repräsentativen Demokratie 166
5.2.2.5 Schutz „unpolitischer“ Kommunikation 168
5.2.2.6 Grundrechte als objektive Werte 169
5.2.3 Petitionen 170
5.3 Die Lebenswirklichkeit 172
5.3.1 Politische Kommunikation 172
5.3.2 Die Teilhabe der Bürger an der politischen Willensbildung 174
5.4 Häufig gestellte Fragen 175
5.5 Texte zur Vertiefung 183
6. Kultur: Entfaltung in Religion, Bildung, Kunst und Wissenschaft 185
6.1 Der Verfassungstext 185
6.2 Die Leitideen 187
6.2.1 Schöpferische Entfaltung und das Streben nach Wahrheit 187
6.2.2 Der besondere Verfassungsrang 188
6.2.3 Grenzen der Freiheit 188
6.2.4 Kulturgrundrechte sind Rechte für jedermann 189
6.2.5 Die Freiheit, nein zu sagen 190
6.2.6 Insbesondere die Religionsfreiheit, Art. 4 GG 190
6.2.7 Insbesondere die Kunstfreiheit, Art. 5 Abs. 3 GG 191
6.2.8 Insbesondere die Wissenschaftsfreiheit, Art. 5 Abs. 3 GG 193
6.2.9 Insbesondere das Schulwesen, Art. 7 GG 194
6.2.10 Der Kulturstaat 195
6.2.11 Die besondere Stellung der Kirchen 196
6.3 Die Verfassungswirklichkeit 197
6.4 Praktische Bedeutung für die Bürger 200
6.5 Häufig gestellte Fragen 201
6.6 Texte zur Vertiefung 208
7. Die Sicherheit der Bürger 209
7.1 Innere Sicherheit 209
7.1.1 Der Verfassungstext 209
7.1.2 Die Leitideen 210
7.1.2.1 Staatsaufgabe und Menschenrecht auf Sicherheit 210
7.1.2.2 Nur wenige Bundeszuständigkeiten 212
7.1.3 Die Verfassungswirklichkeit 212
7.1.4 Praktische Bedeutung für die Bürger 216
7.1.4.1 Zwei widerstreitende Grundbedürfnisse 216
7.1.4.2 Organisationsgrundsätze 217
7.1.5 Häufig gestellte Fragen 219
7.1.6 Texte zur Vertiefung 221
7.2 Äußere Sicherheit (Wehr- und Notstandsverfassung) 222
7.2.1 Der Verfassungstext 222
7.2.2 Die Leitideen 226
7.2.3 Die Verfassungswirklichkeit: Tiefgreifende Veränderungen der Sicherheitslage und der Streitkräfte 227
7.2.4 Praktische Bedeutung für die Bürger 229
7.2.4.1 Der direkte staatliche Zugriff auf den Einzelnen: Dienstpflichten 229
7.2.4.2 Verfassungsrechtliche Schutzmechanismen für Soldaten 230
7.2.4.3 Schutzmechanismen für die Allgemeinheit 231
7.2.5 Häufig gestellte Fragen 234
7.2.6 Texte zur Vertiefung 237
8. Recht haben, Recht bekommen und Justizgrundrechte 238
8.1 Der Verfassungstext 238
8.2 Die Leitideen 242
8.2.1 Die Rechtsweggarantie (Art. 19 Abs. 4 GG) 243
8.2.2 Der Hüter der Verfassung – das Bundesverfassungsgericht 244
8.2.2.1 Allgemeines 244
8.2.2.2 Zuständigkeiten und Verfahren 244
8.2.2.2.1 Streitigkeiten zwischen Verfassungsorganen und föderale Streitigkeiten 245
8.2.2.2.2 Streitigkeiten zum Schutz von verfassungsrechtlichen Rechten des Bürgers 245
8.2.2.2.3 Normenkontrollen 246
8.2.2.3 Aufbau und Organisation des Bundesverfassungsgerichts 246
8.2.3 Gerichtsorganisation und Unabhängigkeit der Richter 246
8.2.4 Die Justizgrundrechte 247
8.2.4.1 Das Recht auf den gesetzlichen Richter (Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG) 247
8.2.4.2 Die Garantien des Art. 103 GG 248
8.2.4.2.1 Art. 103 Abs. 1 GG – Anspruch auf rechtliches Gehör 248
8.2.4.2.2 Art. 103 Abs. 2 GG – Nulla poena sine lege 248
8.2.4.2.3 Art. 103 Abs. 3 GG – Ne bis in idem 248
8.3 Lebenswirklichkeit 249
8.3.1 Rechtsweggarantie 249
8.3.2 Das Bundesverfassungsgericht 249
8.3.3 Gerichtsorganisation 252
8.3.4 Justizgrundrechte 252
8.4 Bürgerbetroffenheit 252
8.5 Häufig gestellte Fragen 253
8.6 Texte zur Vertiefung 257
9. Die Bürger im Bundesstaat 258
9.1 Der Verfassungstext 258
9.2 Die Leitideen 261
9.2.1 Gesamtstaat und Gliedstaaten: Der Bund und die Länder 261
9.2.2 Insbesondere: Gewaltenteilung zwischen Bund und Ländern 262
9.2.3 Verflechtung von Bund und Ländern 264
9.2.4 Leitgedanken der Verfassungsreform 2006: Entflechtung 265
9.3 Die Verfassungswirklichkeit 266
9.4 Praktische Bedeutung für die Bürger 268
9.5 Häufig gestellte Fragen 271
9.6 Texte zur Vertiefung 273
10. Verfassungsorgane und das Personal des Staates 274
10.1 Verfassungsorgane 274
10.1.1 Verfassungstext 274
10.1.2 Die Leitideen 282
10.1.2.1 Die Ausgangslage 282
10.1.2.2 Der Bundestag 283
10.1.2.2.1 Bedeutung und Stellung im politischen System 283
10.1.2.2.2 Rechte und Aufgaben des Bundestages 285
10.1.2.2.3 Gesetzgebungsfunktion als zentrale Entscheidungsbefugnis 285
10.1.2.2.4 Wahlfunktion 286
10.1.2.2.5 Kontrollrechte 286
10.1.2.2.6 Sonstige Rechte 288
10.1.2.2.7 Die Funktionsweise des Bundestages 288
10.1.2.2.8 Arbeitsweise 293
10.1.2.2.9 Wahl, Wahlperiode und Rechtstellung der Abgeordneten 293
10.1.2.2.10 Gesetzgebungsverfahren 293
10.1.2.3 Der Bundesrat 298
10.1.2.3.1 Zusammensetzung und Arbeitsweise des Bundesrates 298
10.1.2.3.2 Rechte und Aufgaben 299
10.1.2.4 Der Bundespräsident 300
10.1.2.4.1 Verfassungsrechtliche Stellung 302
10.1.2.4.2 Wahl und Amtszeit 302
10.1.2.4.3 Kompetenzen und Funktionen 302
10.1.2.4.4 Gnadenrecht (Art. 60 Abs. 2 GG) 303
10.1.2.4.5 Gesetzesausfertigung und -verkündung (Art. 82 Abs. 1 S. 1) 303
10.1.2.4.6 Sonstige Aufgaben 304
10.1.2.4.7 Gegenzeichnungspflicht 306
10.1.2.5 Die Bundesregierung 307
10.1.2.5.1 Kanzlerwahl und Regierungsbildung 307
10.1.2.5.2 Aufgaben und Kompetenzen 308
10.1.2.5.3 Kompetenzen 309
10.1.2.5.4 Ende der Amtszeit 309
10.1.3 Lebenswirklichkeit 309
10.1.3.1 Bundestag 309
10.1.3.2 Bundesrat 310
10.1.3.3 Bundespräsident 311
10.1.3.4 Bundesregierung 312
10.1.4 Bürgerbetroffenheit 312
10.1.5 Häufig gestellte Fragen 312
10.2 Das Personal des Staates 316
10.2.1 Der Verfassungstext 316
10.2.2 Die Leitideen 316
10.2.2.1 Das öffentliche Amt 317
10.2.2.2 Funktionsvorbehalt für Beamte 318
10.2.2.3 Das Beamtenverhältnis 319
10.2.3 Die Lebenswirklichkeit 320
10.2.4 Bürgerbetroffenheit 320
10.2.5 Häufig gestellte Fragen 321
10.2.6 Texte zur Vertiefung 322
11. Die Bürger und der Steuerstaat: 324
11.1 Der Verfassungstext 324
11.2 Die Leitideen 332
11.2.1 Die Verteilung der Finanzierungskompetenzen 333
11.2.2 Steuern und Abgaben 335
11.2.2.1 Grundlagen 335
11.2.2.2 Die Steuern und Abgaben sind zu hoch 338
11.2.3 Die Verschuldung des Staates 342
11.2.4 Föderalismusrefom II 343
11.2.5 Haushaltswirtschaft in Bund und Ländern 345
11.3 Die Lebenswirklichkeit 345
11.4 Die Bürgerbetroffenheit 347
11.5 Häufig gestellte Fragen 347
11.6 Texte zur Vertiefung 353
12. Der Schutz der Zukunftsressourcen 355
12.1 Der Verfassungstext 355
12.2 Die Leitideen 356
12.2.1 Auch Zukunftsressourcen sind ein verfassungsrechtliches Thema 356
12.2.2 Keine Rechte zukünftiger Generationen, aber Staatsziel 357
12.2.3 Nachhaltigkeit 357
12.2.4 Nicht nur Umweltschutz 358
12.2.5 Beschränkung von zulässigen Zukunftsbelastungen – Staatsverschuldung 358
12.2.6 Kein Schutz sämtlicher Zukunftsgüter 359
12.3 Die Verfassungswirklichkeit 359
12.3.1 Auf den Gesetzgeber kommt es an 359
12.3.2 Auch auf die Gesetzgebungskompetenzen in Bund und Ländern kommt es an 361
12.3.3 Schulden sind verführerisch 362
12.4 Praktische Bedeutung für die Bürger 363
12.5 Häufig gestellte Fragen 364
12.6 Texte zur Vertiefung 367
13. Bürger Europas, Völkerrecht 368
13.1 Der Verfassungstext 368
13.2 Die Leitideen 370
13.2.1 Die Verfassung und das Völkerrecht 371
13.2.1.1 Innerstaatliche Zuständigkeit 371
13.2.1.2 Die Übertragung von Hoheitsrechten – Art. 24 GG 372
13.2.1.3 Die Geltung der allgemeinen Regeln des Völkerrechts – Art. 25 GG 373
13.2.1.4 Das Verbot des Angriffskrieges – Art. 26 GG 374
13.2.2 Deutschland als Mitglied in einem Integrierten Europa 374
13.2.2.1 Die grundgesetzliche Integrationsnorm des Art. 23 G 375
13.2.2.2 Europäische Integration und Identität Deutschland 376
13.2.2.2.1 Entwicklung 376
13.2.2.2.2 Verlust nationaler Entscheidungsfreiheit 377
13.2.3 Staatsschulden- und Eurokrise 382
13.3 Die Lebenswirklichkeit 383
13.3.1 Auswärtige Beziehungen 383
13.3.2 Europäische Integration 383
13.4 Die Bürgerbetroffenheit 385
13.5 Häufig gestellte Fragen 385
13.6 Texte zur Vertiefung 387
14. Ist das Grundgesetz zukunftsfähig? 389
14.1 Alte und neue Herausforderungen 389
14.2 Was kann die Verfassung leisten? 391
Stichwortverzeichnis 396
| Erscheint lt. Verlag | 31.8.2015 |
|---|---|
| Verlagsort | Baden-Baden |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Recht / Steuern ► Öffentliches Recht ► Verfassungsrecht |
| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung ► Politische Systeme | |
| Schlagworte | Bundesstaat • Bürgernähe • Bürgerrechte • Erwachsenenbildung • Gemeinwesen • Grundrechte • Nichtjurist • Politiklehrer • Rechtsstaat • Sozialkundelehrer • Verfassungsentfaltung • verfassungskritisch • Verfassungsprinzipien • Verfassungsrecht • Verfassungstext • Verfassungswirklichkeit |
| ISBN-10 | 3-8452-7919-2 / 3845279192 |
| ISBN-13 | 978-3-8452-7919-0 / 9783845279190 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,7 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich