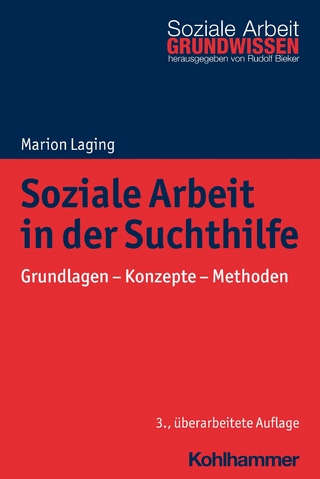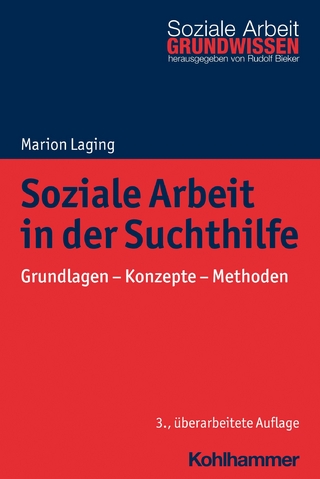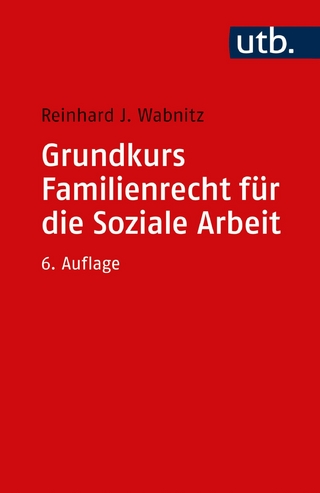Fußballgroßveranstaltungen im Spannungsverhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit (eBook)
XV, 405 Seiten
Springer-Verlag
978-3-662-58864-2 (ISBN)
Thomas ?Kubera
Vorwort 5
Inhaltsverzeichnis 7
Über die Herausgeber und Autoren 8
Abkürzungsverzeichnis 12
Kapitel 1: Einleitung 15
1.1 Zielstellung und Ausgangssituation 15
1.2 Stand der Forschung 17
1.3 Die Projektstruktur und das Vorgehen 18
1.4 Aufbau des wissenschaftlichen Sammelbandes 21
Literatur 22
Kapitel 2: Fußball und Gesellschaft 24
2.1 Einführung 25
2.1.1 Sicherheit und Sicherheitsmaßnahmen aus der Sicht der Betroffenen 25
2.1.2 Wer braucht mehr Sicherheit? Wer will mehr Kommunikation? 26
2.2 Was Fans und „Fanarbeiter“ zu sagen haben … 26
2.2.1 Methodisches Vorgehen 28
2.2.2 Sicht der Fanarbeiter und ihre besondere Stellung im Forschungsfeld 31
2.2.2.1 Hohe Sicherheitswahrnehmung und Anraten zu defensivem Polizeiverhalten 31
2.2.2.2 Kommunikationskultur als akteursübergreifendes Thema 33
2.2.2.3 Bruchstellen der Machtausübung 34
2.2.2.4 Wichtigkeit der Schnittstellenpositionen 35
2.2.2.5 Zwischenfazit 36
2.2.3 Sicht der Fans auf Sicherheit, Freiheit und Kommunikation als deeskalierendes Mittel der Sicherheitsakteure 37
2.2.4 Ableitungen und Überlegungen zu Handlungsempfehlungen 40
2.2.5 Abstraktion und theoretische Anschlüsse 42
2.2.6 Zusammenfassung und Fazit 44
2.3 „Immer schlimmer, immer öfter, immer mehr“? Fußball und Gewalt im Spiegel der Medien seit den 1970er-Jahren 46
2.3.1 Fußball und Gewalt – eine historische Diskursanalyse 47
2.3.1.1 Das immer wiederkehrende Muster vom „Immer schlimmer, immer öfter, immer mehr“ 48
2.3.1.2 Medien und Fußballgewalt – eine symbiotische Beziehung 50
2.3.1.3 Gibt es eine Zunahme von Gewalt bei Fußballspielen im Zeitverlauf? 50
2.3.1.4 Mögliche Gründe für immer wiederkehrende Gewaltausbrüche bei Fußballspielen 52
2.3.2 Thesen zu Merkmalen der Diskurse 54
2.3.2.1 Die Medien werten unterschiedlich und Problemdeutungen sind heterogen 55
2.3.2.2 Der Diskurs wandelt sich (partiell) durch das Web 2.0 55
2.3.2.3 Die Beteiligung am Diskurs ist ungleichgewichtig 56
2.3.2.4 Fans sind nicht gleich Fans 57
2.3.2.5 Konflikte werden weiterentwickelt und Feindbilder (Fans – Polizei) gepflegt 58
2.3.2.6 Die Versicherheitlichung/securitization ist offenkundig 59
2.3.2.7 Begriffsverschiebungen und neue Akzentsetzungen geben nur vermeintlich Hinweise auf die Veränderung des Problems 60
2.3.3 Praktische Schlussfolgerungen 61
Literatur 62
Kapitel 3: Fußball und Sicherheit 65
3.1 Einführung 67
3.1.1 Sicherheit und Freiheit 67
3.1.2 Sicherheitsakteure 69
3.1.3 Perspektiven der Kommunikation 71
3.1.4 Begriff des Polizierens 71
3.1.5 Fokus und Forschungsfeld 72
3.1.6 Inhaltsbeschreibung des Kapitels 75
3.2 Theorie 75
3.2.1 Watzlawicks' fünf Axiome 77
3.2.2 Transparenz und Vertrauen 78
3.2.3 Vertrauensfaktoren 82
3.2.4 One-Voice-Strategie 84
3.2.5 Transparente Kommunikation: Forschungshypothesen 85
3.3 Methodik 90
3.3.1 Qualitative, leitfadengestützte Experteninterviews 92
3.3.2 Systematische empirische Beobachtungen 95
3.3.3 Auswertung der Daten 97
3.3.4 Die vergleichende Methode 101
3.3.5 Handlungsempfehlungen 102
3.4 Die Kommunikation der Polizeien der Länder 103
3.4.1 Die Rolle der Polizeien der Länder 104
3.4.2 Die Organisationsstrukturen und Arbeitsweisen 104
3.4.3 Untersuchungsschwerpunkte und Befunde in Bezug auf die interne Kommunikation 105
3.4.3.1 Vermittlung der Einsatzstrategie 106
3.4.3.2 Vor- und Nachbereitung von Spieltagen 110
3.4.3.3 Fortbildung 111
3.4.3.4 Zwischenfazit 112
3.4.4 Untersuchungsschwerpunkte und Befunde in Bezug auf die externe Kommunikation 113
3.4.4.1 Taktisches Vorgehen 115
3.4.4.2 Nonverbale Kommunikation und Auftreten der Einsatzkräfte 116
3.4.4.3 Taktische Kommunikation 117
3.4.4.4 Fanbriefe und Faninformationen 120
3.4.4.5 Neue und Soziale Medien 122
3.4.4.6 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 123
3.4.4.7 Face-to-face-Kommunikation 124
3.4.4.8 Bewertung der kommunikativen Zugänge 125
3.4.4.9 Mittelbare Fan-Kommunikation 126
3.4.4.10 Zwischenfazit 126
3.4.5 Exkurs: Szenenkundige Beamte (SKB) der Polizei des Landes 128
3.4.5.1 Interne Kommunikationsaufgaben 129
3.4.5.2 Interorganisationale Kommunikationsaufgaben 129
3.4.5.3 Externe Kommunikationsaufgaben 131
3.4.6 Fazit zur Kommunikation der Polizeien der Länder 132
3.5 Die Kommunikation der Bundespolizei 134
3.5.1 Die Rolle der Bundespolizei 135
3.5.2 Die Organisationsstrukturen und Arbeitsweisen 136
3.5.3 Untersuchungsschwerpunkte und Befunde in Bezug auf die interne Kommunikation 136
3.5.3.1 Vermittlung der Einsatzstrategie 137
3.5.3.2 (Vor- und) Nachbereitung von Spieltagen 141
3.5.3.3 Fortbildung 142
3.5.3.4 Zwischenfazit 143
3.5.4 Untersuchungsschwerpunkte und Befunde in Bezug auf die externe Kommunikation 144
3.5.4.1 Taktisches Vorgehen 144
3.5.4.2 Nonverbale Kommunikation und Auftreten der Einsatzkräfte 147
3.5.4.3 Taktische Kommunikation der Polizei des Bundes 151
3.5.4.4 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 154
3.5.4.5 Zwischenfazit 157
3.5.5 Exkurs: Szenenkundige Beamte der Bundespolizei 159
3.5.6 Fazit zur Kommunikation der Bundespolizei 160
3.6 Die Kommunikation der Vereine 162
3.6.1 Die Rolle der Vereine 163
3.6.2 Die Akteure des Vereins 164
3.6.2.1 Der Sicherheitsbeauftragte 165
3.6.2.2 Der Sicherheits- und Ordnungsdienst (SOD) 165
3.6.3 Untersuchungsschwerpunkte und Befunde in Bezug auf die interne Kommunikation 167
3.6.3.1 Aus- und Fortbildung 168
3.6.3.2 Einsatzbesprechung des SOD 171
3.6.3.3 Zwischenfazit zur internen Kommunikation der Vereine 172
3.6.4 Untersuchungsschwerpunkte und Befunde in Bezug auf die externe Kommunikation 173
3.6.4.1 Die Kommunikation mit Fans außerhalb des Spieltages 173
3.6.4.2 Die Nutzung Neuer und Sozialer Medien einschließlich von Fanbriefen und Faninfos 177
3.6.4.3 Kommunikation mittels Beschallungsanlagen im Stadionbereich 179
3.6.4.4 Zwischenfazit externe Kommunikation der Vereine 181
3.6.5 Exkurs: Funktion und Kernaufgaben des Sicherheitsbeauftragten 182
3.6.6 Fazit zur Kommunikation der Vereine 184
3.7 Die Kommunikation der Kommune 186
3.7.1 Die Aufgaben der Kommune 186
3.7.1.1 Kommunale Selbstverwaltung 187
3.7.1.2 Staatliche Aufgaben der Kommune 188
3.7.2 Untersuchungsschwerpunkte und Befunde in Bezug auf die interne Kommunikation 189
3.7.2.1 Vermittlung der Einsatzstrategie 190
3.7.2.2 Fortbildung der Außendienstkräfte 191
3.7.2.3 Einbindung in Konzeptionen 192
3.7.2.4 Koordinierung der Zusammenarbeit 193
3.7.2.5 Zwischenfazit 195
3.7.3 Untersuchungsschwerpunkte und Befunde in Bezug auf die externe Kommunikation 196
3.7.3.1 Öffentlichkeitsarbeit 196
3.7.3.2 Beteiligung am Fandialog 198
3.7.3.3 Kommunale Präsenz am Spieltag 199
3.7.3.4 Vorfeld- und wegbezogene Maßnahmen 200
3.7.3.5 Zwischenfazit 202
3.7.4 Fazit zur Kommunikation der Kommune 203
3.8 Interorganisationale Kommunikation 205
3.8.1 Besprechungsbasierte Kommunikation 207
3.8.1.1 Besprechungen (spieltagsunabhängig) 207
3.8.1.1.1 Saisonbesprechungen 208
3.8.1.1.2 Örtlicher Ausschuss Sport und Sicherheit (ÖASS) 209
3.8.1.1.3 Informelle Besprechungen 210
3.8.1.2 Besprechungen (spieltagsbezogen) 210
3.8.1.2.1 Sicherheitsbesprechung vor dem Spieltag 210
3.8.1.2.2 Sicherheitsgespräch am Spieltag 211
3.8.1.2.3 Kurvengespräche 212
3.8.1.2.4 De-Briefings 213
3.8.1.2.5 Nachbesprechungen 213
3.8.1.3 Zwischenfazit zu spieltagsbezogenen und spieltagsunabhängigen Besprechungen 214
3.8.2 Bilaterale Kommunikation 216
3.8.3 Besprechungsbasierte und bilaterale Kommunikation im Abgleich 220
3.8.4 Fazit zur interorganisationalen Kommunikation 222
3.9 Fazit zu Fußball und Sicherheit 223
3.9.1 Organisationsbezogene Kommunikation in der Sicherheitsgewährleistung beim Fußball 224
3.9.2 Die Forschungshypothesen und die Verbesserung der Kommunikation 226
3.9.3 Das Spannungsverhältnis zwischen Sicherheit und Freiheit im Kontext des Communicative Policing 227
Literatur 229
Kapitel 4: Fußball und Kommunikationstechnik 236
4.1 Thematische Einführung 237
4.2 Anforderungsanalyse 237
4.3 Nutzung von Ontologien 239
4.4 Architektur der Kommunikationsplattform 242
4.5 Positionsbestimmung 244
4.6 Demonstrator und Live-Test 252
4.7 Empfehlungen 267
4.7.1 Empfehlung für den Demonstrator 267
4.7.2 Empfehlung für die Ontologie 268
4.7.3 Empfehlung für die Kommunikationsplattform 269
4.7.4 Empfehlung für die mobile Plattform 269
4.7.5 Empfehlung für mobile Endgeräte 269
4.7.6 Empfehlung für das Data Farming Cluster 269
4.7.7 Empfehlung für eine sichere Kommunikationslösung auf öffentlichen Netzwerken 270
4.8 Fazit 270
Literatur 271
Kapitel 5: Fußball und Recht 272
5.1 Einführung 273
5.1.1 SiKomFan und Recht 273
5.1.2 Ist-Zustands-Analyse (Rechtliche Rahmenbedingungen) 275
5.1.2.1 Identifizierung und Benennung der Sicherheitsakteure 276
5.1.2.2 Zuordnung von Verantwortungsbereichen 278
5.1.2.3 Bestimmung und Festlegung der Aufgaben 279
5.1.2.3.1 Sicherheitsakteure der öffentlichen Hand 280
5.1.2.3.2 Sicherheitsakteure des Privatrechtssektors 280
5.1.2.3.3 Berücksichtigung des Datenschutzes 281
5.1.2.4 Untersuchung der Steuerungsinstrumente/Befugnisse 282
5.1.3 Ansätze einer kooperativen Sicherheit 283
5.1.4 Zwischenergebnis 284
5.2 Kommunikationsprozesse und Zuständigkeiten hinsichtlich Gefahrenabwehrmaßnahmen der Polizei- und Ordnungsbehörden 284
5.2.1 Maßnahmenbündel der öffentlich-rechtlichen Akteure im Vorfeld und während des Spieltags als Voraussetzung und Folge von Kommunikation 285
5.2.1.1 Die Bildung der Gefahrenprognose – Gestuftes Informationshandeln der Akteure 285
5.2.1.1.1 Beurteilung der allgemeinen Gefahrenlage – das „ob“ der Gefahrenabwehr 286
5.2.1.1.2 Einsatztaktischer Informationsaustausch Spieltags- und Ortsbezogen – das „wie“ der Gefahrenabwehr 288
5.2.1.1.3 Die Validität der individuell-konkreten Gefahrenprognose (3. Stufe) 288
5.2.1.1.3.1 Eintrag Datei Gewalttäter Sport 289
5.2.1.1.3.2 Erkenntnisse aus strafrechtlichen Ermittlungsverfahren 290
5.2.1.1.3.3 Berücksichtigung bereits erlassener Stadionverbote 291
5.2.1.1.3.4 Zeitnähe der Informationen 292
5.2.1.1.3.5 Drittortauseinandersetzungen 293
5.2.1.1.3.6 Zugehörigkeit Hooligan- oder Ultragruppierung und Zurechnung 294
5.2.1.1.4 Fazit und Optimierungspotenzial 295
5.2.1.2 Ausgewählte polizeiliche Maßnahmen und Problemstellungen 295
5.2.1.2.1 Kommunikation – Möglichkeiten und Grenzen 295
5.2.1.2.1.1 Kommunikation zur Erkenntnisgewinnung und Organisation 296
5.2.1.2.1.1.1 Kommunikative Befugnisse 296
5.2.1.2.1.1.2 Kommunikation als grundrechtsneutrale Sicherheitsgewährleistungsaufgabe (Taktische Kommunikation) 297
5.2.1.2.1.1.3 Zusammenfassende Optimierungsansätze 298
5.2.1.2.1.2 Kommunikation zur Adressierung und Abwehr von Gefahren: Die Gefährderansprache 299
5.2.1.2.1.3 Feste Grenzen und Rollen für Kommunikation 300
5.2.1.2.2 Regelungsbedürftige Maßnahmen der Gefährderansprache und der Meldeauflage 301
5.2.1.2.2.1 Verfassungsrechtliche Erfordernisse einer Normierung: Grundrechtsintensität und Wesentlichkeitslehre 301
5.2.1.2.2.2 Praktische Erfordernisse einer Normierung 303
5.2.1.2.2.3 Ausgestaltung und Regelungsvorschläge 304
5.2.1.2.2.4 Regelungsvorschläge 306
5.2.1.2.3 Fanleitung im Spannungsverhältnis zwischen Organisation und Freiheitsbeschränkung 306
5.2.1.2.3.1 Fanleitungsmaßnahmen 307
5.2.1.2.3.2 Grundrechtsintensität 307
5.2.1.2.3.3 Rechtsrahmen der Ausübung 309
5.2.1.2.3.4 Fazit und Optimierungspotenziale 310
5.2.1.2.4 Politisierung der Fanszene – Fanmärsche als Versammlung oder veranstaltungsbezogene Ansammlung 311
5.2.1.2.4.1 Wandel der Fanstrukturen 311
5.2.1.2.4.2 Wandel der Sicherheitsgewährleistung 311
5.2.1.2.4.3 Konsequenzen: Höhere Eingriffsschwelle und das Gebot der Kooperation 313
5.2.1.3 Ausgewählte Handlungsinstrumente der Kommune 314
5.2.1.3.1 Die Kommune als Organ der Gremienarbeit und Kriminalprävention 314
5.2.1.3.2 Allgemeinbezogene abstrakt-generelle Handlungsinstrumente per Allgemeinverfügung oder Verordnung 315
5.2.1.3.2.1 Gefahrenabwehrverordnungen, insbesondere Alkoholverbote 316
5.2.1.3.2.2 Verhaltenssteuerung der Zuschauer durch Normsetzung 316
5.2.1.3.2.3 Verfügungen gegenüber Kollektive durch Allgemeinverfügungen 318
5.2.1.3.2.4 Abstrakt-generelle Maßnahmen unter der Prämisse der Einzelfallgerechtigkeit 319
5.2.2 Zuständigkeitsschnittstellen und Kooperative Zusammenarbeit der Sicherheitsakteure 320
5.2.2.1 Polizeien der Länder, Bundespolizei und Deutsche Bahn AG im Raum des Bahnhofs 320
5.2.2.1 Zuständigkeitsabgrenzungen der Akteure und Sicherheitsgewährleistungsaufgaben 321
5.2.2.1.1.1 Bundespolizei – DB AG: Getrennte Verantwortungen für unterschiedliche Gefahrenherde 321
5.2.2.1.1.2 Bundespolizei – Polizei des Landes: Funktional – räumliche Trennung – Unterstützung in Grenzen 322
5.2.2.1.2 Zusammenarbeit der Akteure 323
5.2.2.1.2.1 Kooperation Bundespolizei – DB AG 323
5.2.2.1.2.2 Kooperation Bundespolizei – Polizei des Landes 324
5.2.2.2 Polizei (in der Rolle der Vollzugspolizei) und Ordnungsbehörde (in der Rolle der Kommune) im Vorfeld der Spieltage 325
5.2.2.2.1 Heterogene gesetzliche Ausgestaltungssituation der Beziehung 325
5.2.2.2.2 Getrennt oder gemeinsam wahrgenommene Befugnisse zur Sicherheitsgewährleistung bei Fußballspielen 326
5.2.2.2.3 Polizei als Akteur der personenbezogenen Gefahrenabwehr im Vorfeld des Spieltags 326
5.2.2.3 Die Sicherheitsgewährleistung der Polizei und des Vereins im Stadion 327
5.2.2.4 Fazit: Verteilte Verantwortung für eine gesamtheitliche Sicherheitsgewährleistung 329
5.3 Zivilrechtliche Steuerungsinstrumente im Fußball 329
5.3.1 Vereine/Kapitalgesellschaften 330
5.3.1.1 Der „Raum Stadion“ als originärer Verantwortungsbereich der Vereine/Kapitalgesellschaften 330
5.3.1.2 Die Muster-Versammlungsstättenverordnung als Perspektivanker zur Aufgabenbestimmung für die Vereine und als Nahtstelle zur öffentlich-rechtlichen Sicherheitsgewährleistung 331
5.3.1.3 Die Begründung gesetzlicher Schutzpflichten über den Perspektivanker der Verkehrspflichten als zivilrechtliches Steuerungsinstrument 334
5.3.1.4 Zusammenfassung und Zwischenergebnis 336
5.3.2 Fanbeauftragter 337
5.3.2.1 Räumlicher und funktionaler Verantwortungsbereich der Fanbeauftragten 338
5.3.2.2 Aufgabenfeld und Befugnisse bzw. Steuerungsinstrumente des Fanbeauftragten 339
5.3.2.3 Rollenwahrnehmung im Verhältnis zu den Fanprojekten 341
5.3.3 Sicherheitsbeauftragte 342
5.3.3.1 Qualifikation 342
5.3.3.2 Abgeleiteter Verantwortungsbereich der Sicherheitsbeauftragten 343
5.3.3.3 Aufgabenbereich der Sicherheitsbeauftragten 344
5.3.3.4 Befugnisse/Steuerungsinstrumente 345
5.3.3.5 Verhältnis des Sicherheitsbeauftragten zum Veranstaltungsleiter 346
5.3.3.6 Zwischenergebnis zum Sicherheitsbeauftragten 348
5.3.4 Verband 348
5.3.4.1 Regelungskompetenzen der Verbände als Kommunikationsmotor und Dialoghilfe für die Vereine 349
5.3.4.2 Die Lizenzierungsordnung, der Anhang VI und die Konformitätserklärung der DFL als Regelungsmechanismus und notwendige Voraussetzung für die Lizenzerteilung 350
5.3.4.3 Besonderheiten bei der Organisation der 3. Liga durch den DFB mit dem Statut 3. Liga 355
5.3.4.4 Die Richtlinie zur Verbesserung der Sicherheit bei Bundesspielen (RLVSB) als zentraler verbandsrechtlicher Aufgabenkatalog an die Vereine 355
5.3.4.5 Die Verbandshoheit als Regelungsmechanismus zur Entwicklung von allgemeinen Steuerungsinstrumenten im Fußball am Beispiel des Stadionverbots 359
5.3.4.6 Zwischenergebnis und Zusammenfassung Verband 361
5.4 Datenschutz als Baustein der Kommunikation zur Generierung von Sicherheit 361
5.4.1 Datenschutz als Rechtsrahmen für Kommunikation 362
5.4.2 Ausgewählte datenschutzrechtliche Problemstellungen 364
5.4.2.1 Die Speicherung personenbezogener Daten in Dateien durch die Polizei 364
5.4.2.1.1 Datei Gewalttäter Sport 365
5.4.2.1.1.1 Die Erfassungskriterien 367
5.4.2.1.1.2 Die datenschutzrechtliche Verantwortung 369
5.4.2.1.1.3 Die Aktualität der Daten 370
5.4.2.1.1.4 Die Folgen einer Eintragung 372
5.4.2.1.1.5 Die (fehlende) Transparenz der Datei Gewalttäter Sport 372
5.4.2.1.2 Arbeitsdateien 374
5.4.2.1.2.1 Das Verhältnis zur Datei Gewalttäter Sport 375
5.4.2.1.2.2 Die Eintragung in der Arbeitsdatei 376
5.4.2.1.3 Zwischenergebnis 377
5.4.2.2 Die Datenübermittlung zur Anregung von Stadionverboten 377
5.4.2.3 Technische Lösungen zur Verbesserung der Kommunikation und des Dialogs 380
5.4.3 Datenschutz im Spannungsfeld von Freiheit und Sicherheit 381
5.5 Zusammenfassung 382
Literatur 383
Kapitel 6: Fazit: Sicherheit, Kommunikation und Freiheit 388
6.1 Die Ergebnisse des Forschungsprojekts SiKomFan 390
6.2 Sicherheit, Kommunikation und Freiheit aus interdisziplinärer Perspektive 395
6.3 Ausblick: Sicherheit und Kommunikation im Fußball 398
Stichwortverzeichnis 400
| Erscheint lt. Verlag | 3.12.2019 |
|---|---|
| Zusatzinfo | XV, 394 S. 27 Abb., 25 Abb. in Farbe. |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Gesundheit / Leben / Psychologie |
| Recht / Steuern ► EU / Internationales Recht | |
| Recht / Steuern ► Öffentliches Recht | |
| Sozialwissenschaften ► Pädagogik ► Sozialpädagogik | |
| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung | |
| Schlagworte | Fandialog • Fußball • Kommunikation • Recht • Sicherheit |
| ISBN-10 | 3-662-58864-1 / 3662588641 |
| ISBN-13 | 978-3-662-58864-2 / 9783662588642 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 6,4 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich