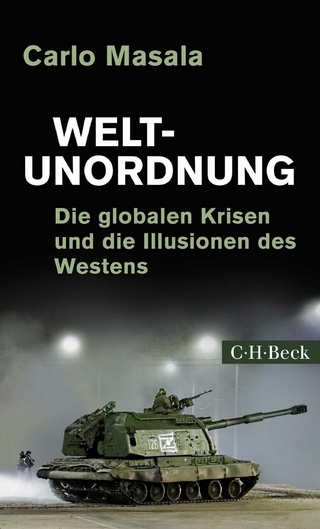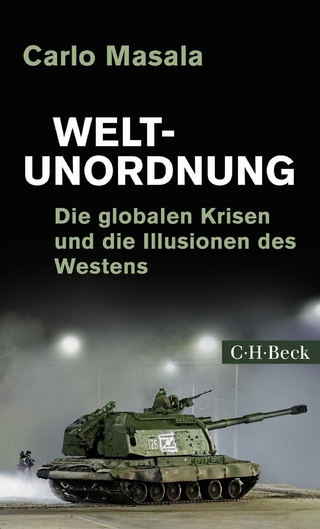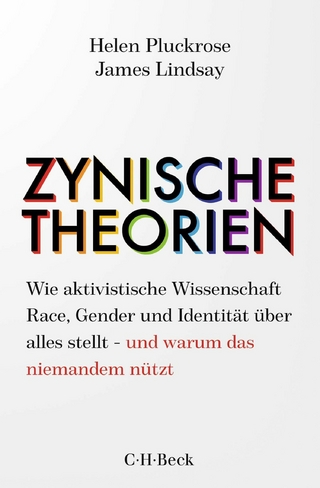Das ist auch unser Land! (eBook)
256 Seiten
Ch. Links Verlag
978-3-86284-480-7 (ISBN)
Dieses Buch beruht auf Gesprächen mit den Rappern Celo & Abdï, der Influencerin Gözde Duran, dem DFB-Integrationsbeauftragten Cacau, der Hip-Hop-Promoterin Marina Buzunashvilli, dem Regisseur Neco Celik, der Boxweltmeisterin Nikki Adler und dem Boxweltmeister Jack Culcay, dem Friseur und Unternehmer Shan Rahimkhan, dem Model und Influencer Kaan Tosun, dem Sneaker-Designer Hikmet Sugör, dem Hip-Hop-Produzenten Mohamad Hoteit (aka The Royals), den Dulatov-Brüdern - Models und Mixed-Martial-Arts-Kämpfer -, dem Labelbetreiber Syn und vielen anderen.
Jahrgang 1987, ist in Deutschland geboren und aufgewachsen. Sie hat Politikwissenschaft in Darmstadt und Konfliktforschung in Istanbul studiert und ihren Master am King's College in London gemacht. Derzeit promoviert sie an der LMU München in Politischer Theorie über Identitätspolitik. Seit 2013 schreibt sie als freie Journalistin u. a. für Die Welt, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Zeit Online, Tagesspiegel, Jüdische Allgemeine und Neue Zürcher Zeitung.
Jahrgang 1987, ist in Deutschland geboren und aufgewachsen. Sie hat Politikwissenschaft in Darmstadt und Konfliktforschung in Istanbul studiert und ihren Master am King's College in London gemacht. Derzeit promoviert sie an der LMU München in Politischer Theorie über Identitätspolitik. Seit 2013 schreibt sie als freie Journalistin u. a. für Die Welt, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Zeit Online, Tagesspiegel, Jüdische Allgemeine und Neue Zürcher Zeitung.
EINLEITUNG
Auf die Frage, ob ich Deutscher bin, kann ich nur sagen, dass ich in jedem Fall gerne in Deutschland bin. Ćelo & Abdï, »Diaspora«
Hanau, 20. Februar 2020: Als ich mich einem der Tatorte nähere, fällt mir jeder weitere Schritt schwer. Mein Körper ist wie erstarrt, ich kämpfe mit den Tränen und ermahne mich immer wieder, dass ich mich sammeln muss. Schließlich bin ich als Journalistin hier. Ich bin gekommen, um über einen Anschlag zu berichten. Einen Anschlag auf Menschen wie mich.
Vor dem Kurt-Schumacher-Platz haben sich viele Leute versammelt. Sie stehen einfach da, ungläubig, starren auf die Bar, auf den Kiosk, schauen um sich, ganz so, als ob sie sich vergewissern wollten, dass sie sich noch immer in Hanau befinden und nicht in einer fremden Stadt. Am Vorabend ist ein Mann in die beiden Läden gestürmt, hat fünf Menschen ermordet und mehrere verletzt; kurz zuvor hat er bereits ein paar Kilometer weiter am Heumarkt vor der Bar »La Votre« und der Shishalounge »Midnight« um sich geschossen. Dabei und auf dem Weg vom einen Tatort zum anderen tötete er vier weitere Menschen. Abgesehen von seiner Mutter, die der Täter erschoss, bevor er sich selbst das Leben nahm, haben alle Opfer einen Migrationshintergrund; viele sind hier aufgewachsen, einige haben einen deutschen Pass.
Als ich morgens auf meinem Handydisplay las, dass es in einer Hanauer Shishabar eine Schießerei gegeben habe, kam mir kurz der Gedanke, es könne sich um eine Auseinandersetzung innerhalb des Milieus handeln, dass verfeindete Gruppen aneinandergeraten sind. Dann kam die Meldung, wie viele Menschen dabei gestorben sind. Und ich wusste sofort, das war ein Anschlag. Ein Anschlag auf uns.
Wir, das sind die »Ausländer«. Mein Großvater Ali Toprak ist 1966 als Gastarbeiter aus einem anatolischen Dorf nahe der Stadt Erzincan nach Deutschland gekommen; 1971 holte er meine Großmutter und die sieben Kinder nach, mein Vater war damals 15. »Ausländer«, dieses Wort höre ich am Kurt-Schumacher-Platz immer wieder von Menschen, die offenbar einen Migrationshintergrund haben, egal ob sie jung oder alt, ob sie in Deutschland oder anderswo geboren sind. Und es wird klar: Nach den Anschlägen sind wir keine Deutschen mehr, aber auch keine Marokkaner, Türken oder Äthiopier, und ebenso wenig Muslime oder Christen. Wir sind alle eins, wir sind anders, wir sind Ausländer.
Auf dem Weg nach Hanau traf ich meinen Vater und erzählte ihm, was vorgefallen war. Er war betroffen, aber nicht wirklich schockiert. Unsere Eltern und Großeltern können sich sehr gut an Mölln und Solingen erinnern, sie wissen, das war nicht die erste Tat in Deutschland mit einem rassistischen Hintergrund und vermutlich auch nicht die letzte. Außerdem haben viele, die irgendwann nach Deutschland eingewandert sind, in ihren Heimatländern Verfolgung, Diskriminierung und Massaker erleben müssen, zum Teil seit Generationen. Sie haben sich – so traurig es ist – an kollektive Gewalt schon gewöhnt.
Für meine Generation jedoch hat der Anschlag von Hanau vom 19. Februar 2020 eine tiefe Wunde hinterlassen. Wir sind in Deutschland geboren oder zumindest aufgewachsen, viele von uns fühlen sich dem Land eng verbunden oder sehen sich als Deutsche. Und wir hatten das Gefühl, dass auch die Mehrheit in diesem Land verstanden hat, dass hier unsere Heimat ist, dass wir keine fremden Kinder sind, die irgendwann wieder »nach Hause« gehen werden.
Hanau aber hat uns mit einem Schlag wieder daran erinnert, dass wir Ausländer sind – dass wir irgendwie doch nicht dazugehören, weil wir nicht dazugehören sollen. Der Terrorakt macht auch die ganz alltäglichen Ausgrenzungen wieder bewusst, die uns glauben lassen sollen, dass wir anders sind, dass wir nicht zu den Deutschen gehören und das auch gar nicht können. Dabei sind wir längst ein Teil von euch und ihr seid auch ein Teil von uns.
Wie werden die Taten von Hanau uns als Gesellschaft verändern, werden sie das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft erschweren oder vereinfachen? Werden wir zusammenwachsen, oder werden wir auseinandergehen? Diese Fragen beschäftigen mich, seit ich an diesem regnerischen, grauen und traurigen Tag in Hanau war. Die Grenzen zwischen dem Deutschsein und dem Ausländersein scheinen wieder stärker zu sein als vorher. Ist das Band zwischen diesem Land und uns, jenen mit Migrationshintergrund, so dünn, dass es jedes Mal abreißt, wenn es zu solch einer grauenvollen Tat kommt? Wann fühlen wir uns deutsch und wann als Ausländer? Gehören wir zu Deutschland und, falls ja, zu welchem Deutschland – einem, in dem Zugehörigkeit ethnisch definiert wird, oder einem, in dem dafür andere Kriterien zugrunde gelegt werden?
Wenn es um Einwanderung, Integration und Identität geht, neigen die Beiträge zur öffentlichen Debatte meist einem von zwei Lagern zu. Das eine Lager verleugnet, dass Ausgrenzung vonseiten der Mehrheitsgesellschaft ein Problem ist, und sieht eher eine Selbst-Ausgrenzung der migrantischen Communitys: Sie seien zu religiös, könnten zu wenig Deutsch, hingen zu sehr an ihren Heimatländern, arbeiteten zu wenig und die Kinder nähmen die Schule nicht ernst genug. Das könnte man die rechte Antwort auf das Thema »Einwanderung« nennen.
Das andere Lager bilden Menschen mit Migrationshintergrund, die gerne die Opferkarte ausspielen und in der Opferrolle verharren. Sie selbst haben es meist in der Politik oder den Medien nach oben geschafft, finden Gehör in der Öffentlichkeit, rufen aber in die Communitys hinein: »Ihr werdet es niemals schaffen, ganz egal, wie viel Mühe ihr euch gebt, die Deutschen sind Rassisten, Rassismus gibt es nicht nur an den Rändern, sondern auch in der Mitte der Gesellschaft. Es gibt Grenzen für euch, ihr müsst euch vor Diskriminierung fürchten, egal wo, egal wann.«
Zu diesem Lager gehören auch Deutsche ohne ausländische Wurzeln. Sie halten sich für antirassistisch und meinen, Migranten und Deutsche mit ausländischen Wurzeln seien Opfer, die sie vor den Deutschen beschützen müssten. Dadurch geben sie diesen Menschen das Gefühl, dass sie über ihnen stehen; einer Auseinandersetzung mit den Problemen von Einwanderung auf Augenhöhe gehen sie aus dem Weg. Dabei hängen sie einem Kulturrelativismus an, der seinerseits Menschen anders macht. So glauben sie etwa, dass Frauen aus migrantischen Communitys aufgrund ihrer Kultur oder Religion nicht so frei und gleich leben müssten wie deutsche Frauen.
Es ist die linke Antwort auf das Thema Einwanderung, und sie hat mit der rechten zwei Gemeinsamkeiten. Zum einen verraten beide die Grundidee unserer Gesellschaft, dass wir Rechte und Pflichten als Individuen und nicht als Mitglieder von Gruppen haben. Sie sehen und erkennen uns nur als Kollektiv an, nicht als Einzelne. Zum anderen betonen beide nur die Unterschiede zwischen Menschen, statt sich auf Gemeinsamkeiten zu besinnen. Während die Linken diese Unterschiede als positiv deklarieren, glauben die Rechten, dass alles, was anders ist als sie selbst, automatisch schlechter ist. Einen Weg zu finden, mit Unterschieden umzugehen und sich zugleich auf Gemeinsamkeiten zu verständigen – das ist die entscheidende Herausforderung in einer liberal-demokratischen Einwanderungsgesellschaft.
Um zu verstehen, was Menschen mit ausländischen Wurzeln selbst über Einwanderung, Integration und Identität denken, was das Leben in Deutschland für sie bedeutet, habe ich mit einer ganzen Reihe von ihnen gesprochen. Die meisten sind entweder in Deutschland geboren, haben aber Familien mit Wurzeln im Ausland, oder sie mussten als Kind oder Jugendliche nach Deutschland flüchten und sind hier aufgewachsen. Es sind Gastronomen darunter, Sportler, Journalisten, Künstler und viele mehr. Menschen, die das Land im Großen und Kleinen prägen.
Ich habe sie gefragt: Wie hat sich Deutschland durch Migration verändert – und wie die migrantischen Communitys in Deutschland? Haben sie deutsche Normen übernommen, stehen sie hinter deutschen Werten, oder schotten sie sich tatsächlich ab? Hat sich umgekehrt Deutschland geöffnet, oder ist es rassistischer geworden? Erfahren sie selbst Vorurteile und Diskriminierung – und wie gehen sie damit um? Glauben sie, dass man es in Deutschland schaffen kann? Empfinden sie sich als Deutsche? Natürlich wollte ich wissen, was der Anschlag von Hanau in ihnen ausgelöst hat, ob sie sich seitdem unerwünschter im Land fühlen. Eine ähnlich wichtige Rolle in den Gesprächen spielten der Fall Mesut Özil und die Wahlerfolge der AfD.
Ich spreche im Buch von »Ausländern« und »Deutschen«, denn diese Begriffe wurden von allen meinen Gesprächspartnerinnen und -partnern verwendet. Denn immer dann, wenn wir über die Unterschiede zwischen den Kulturen, über Diskriminierung, Ausgrenzung, Vorurteile und Rassismus sprechen, darüber, was uns voneinander trennt, dann sprechen wir von »Ausländern« und von »Deutschen«. Selbst Menschen, die sich diesem Land zugehörig...
| Erscheint lt. Verlag | 7.10.2020 |
|---|---|
| Verlagsort | Berlin |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Politik / Gesellschaft |
| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung | |
| Schlagworte | assimilation • Celo & Abdi • Deutschrap • Einwanderung • Günter Wallraff • Hanau • Identitätspolitik • Integration • Migration • Nikki Adler • Rassismus |
| ISBN-10 | 3-86284-480-3 / 3862844803 |
| ISBN-13 | 978-3-86284-480-7 / 9783862844807 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 447 KB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich