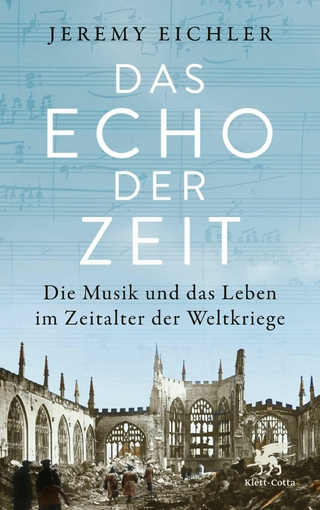Erinnerungen an das Warschauer Ghetto. Das Ghetto kämpft (eBook)
240 Seiten
Reclam Verlag
978-3-15-962221-7 (ISBN)
Marek Edelman (ca. 1919 - 2009) war Mitglied des Allgemeinen Jüdischen Arbeiterbunds und spielte eine entscheidende Rolle beim Aufstand im Warschauer Ghetto 1943 sowie 1944 beim allgemeinen Warschauer Aufstand gegen die NS-Besatzer. Nach dem Krieg wurde er Arzt und Abgeordneter im polnischen Parlament. Ewa Czerwiakowski ist freie Publizistin und Übersetzerin aus dem Polnischen. Das 'Ghetto kämpft' hat sie zusammen mit Jerzy Czerwiakowski übersetzt. Jens Hagestedt, geb. 1958, übersetzt Sachbücher aus dem Englischen und Französischen. Constance Pâris De Bollardière ist stellvertretende Direktorin am George and Irina Schaeffer Center for the Study of Genocide, Human Rights, and Conflict Prevention der American University in Paris.
Marek Edelman (ca. 1919 – 2009) war Mitglied des Allgemeinen Jüdischen Arbeiterbunds und spielte eine entscheidende Rolle beim Aufstand im Warschauer Ghetto 1943 sowie 1944 beim allgemeinen Warschauer Aufstand gegen die NS-Besatzer. Nach dem Krieg wurde er Arzt und Abgeordneter im polnischen Parlament. Ewa Czerwiakowski ist freie Publizistin und Übersetzerin aus dem Polnischen. Das "Ghetto kämpft" hat sie zusammen mit Jerzy Czerwiakowski übersetzt. Jens Hagestedt, geb. 1958, übersetzt Sachbücher aus dem Englischen und Französischen. Constance Pâris De Bollardière ist stellvertretende Direktorin am George and Irina Schaeffer Center for the Study of Genocide, Human Rights, and Conflict Prevention der American University in Paris.
[9]Vorwort
2. Oktober 2009, 21 Uhr. Der Flughafen von Paris-Beauvais. Ich bereite mich auf den Flug mit der letzten Maschine nach Warschau vor. Geplante Ankunft: gegen 23 Uhr. Die Langeweile des Wartens auf den Flughäfen. Heute Morgen hat mich meine Schwester Ania angerufen, um mir zu sagen, dass sich der Zustand unseres Vaters verschlechtert habe. Ein Gedanke jagt den anderen: Wird die Maschine pünktlich sein? Was soll ich – es wird ja fast Mitternacht sein – nach der Ankunft tun? Soll ich zu meinem Vater fahren oder in der Einzimmerwohnung übernachten, in der meine Mutter gewohnt hat? Wo werde ich in Warschau schlafen? Wird es, wie seit einiger Zeit, wieder Spannungen mit den Freunden meines Vaters geben? Über den Lautsprecher wird der Check-in für den Flug nach Warschau angekündigt. Wir besteigen die Maschine. Ich nehme Platz. Im selben Moment klingelt mein Handy und Ania teilt mir mit, dass mein Vater gestorben ist.
Zwei Stunden später lande ich in Warschau. Ich nehme ein Taxi und lasse mich zu der Wohnung fahren, in der mein Vater vor drei Stunden verstorben ist. Im Esszimmer sitzen einige Leute um einen Tisch herum. Sie reden laut und lachen. Ich gehe gleich in das kleine Zimmer am Ende des Flurs. Dies sind seine letzten Tage hier. Er liegt in seinem Bett, sein Gesicht ist eingefallen, ruhig, fast nicht wiederzuerkennen.
Wie ist die Woche danach verlaufen? Ich habe keine Erinnerung daran. Am 9. Oktober, dem Tag der Beerdigung, waren wir [10]allein in der Menge während der offiziellen Reden am Denkmal für die Kämpfer des Warschauer Ghettos, später gingen wir, wieder allein, mit in dem Zug, der den mit der Fahne des Bund bedeckten Sarg – Zosia hatte das Stück Stoff eigens aus Paris mitgebracht – zu dem zwei Kilometer entfernten jüdischen Friedhof geleitete. An der Spitze des Zuges gingen Musiker und spielten Jazz. Um uns kümmerte sich niemand. Jeder in der Menge war ein »sehr enger Freund« von Marek gewesen, wir waren überflüssig.
Stunden später kommen wir in Łódź an, wo wir gewohnt hatten, bevor wir 1972 nach Paris gingen. Die Wohnung ist leer. An den Wänden hängen nur noch die Bilder von Z., die wir unserem Vater mitbrachten, seit wir ihn 1991 erstmals besuchen konnten. Die Bibliothek unserer Großeltern. Ich erinnere mich, dass sie vor Büchern überquoll. Während der Stalin-Zeit waren hinter Reihen von medizinischen Büchern Das Ghetto kämpft, Wierniks Bericht über die Morde in Treblinka und über seine Flucht sowie andere Schriften des Bund versteckt gewesen, nachdem sie im Januar 1949 von der kommunistischen Partei verboten worden waren. Jetzt ist von all den Büchern fast nichts mehr da. In der Mitte des Wohnzimmers stehen noch der Tisch, an dem wir gegessen haben, und der alte Sessel.
Die Freunde, die uns hierher begleitet haben, sehen unsere Ratlosigkeit. Eine Freundin ruft mich.
»Schau dir diese Notizbücher an. Kennst du die? Wir haben sie in den aussortierten Papieren deiner Mutter gefunden. Niemand hatte in diese Schublade geschaut. Ich habe es der Ordnung halber getan. Nur deshalb sind sie noch da.«
Ich gehe hin und erkenne die – fast unleserliche – Handschrift meines Vaters. Ulica Chłodna1, die Bilder kommen rasch zurück. Wir befinden uns im Jahr 1967. Oder ist es Anfang 68? Nein, es ist Herbst 67. Ich bin mir ganz sicher. Ich sehe meine [11]Eltern im Hauseingang, sie sprechen miteinander. Ich war gerade auf Tour mit den Kumpels und möchte meinen alten Herrschaften nicht in dem Moment begegnen, in dem ich von meinen Eskapaden heimkomme. Aber sie beachten mich nicht. Ich höre:
»Auch Rakowski hat abgelehnt.«
Ich habe gerade an etwas anderes gedacht, aber jetzt höre ich zu. Ich weiß, dass Rakowski der Chefredakteur der politisch-kulturellen Wochenzeitung Polityka ist. Meine Eltern betreten das Wohnzimmer und rufen mich.
»Hier, lies das.«
Sagt meine Mutter. Ich werfe einen Blick darauf: Ulica Chłodna.
Es ist das erste Mal, dass sie mir etwas zu lesen geben. Das Ghetto kämpft, den Bericht über den Aufstand im Warschauer Ghetto, den mein Vater nach dem Krieg für die Führungsgremien des Bund geschrieben hatte, habe ich selbst gefunden – das Büchlein war hinter der ersten Reihe der Handbücher für Medizin versteckt. Ich war damals zwölf. Ich nehme die Notizbücher, aber sie geben mir einige mit Schreibmaschine beschriebene Blatt Papier. Meine Mutter sagt zu mir:
»Lies es, es wurde von der Kultura und jetzt auch von der Polityka abgelehnt.«
Die Kultura ist eine den Machthabern nahestehende kulturelle Wochenzeitung. Deren Absage hatte meine Eltern nicht überrascht. Aber Polityka? Das hatten sie nicht erwartet. Genauso wenig hatten sie damit gerechnet, dass Władysław Machejek, der Chefredakteur von Życie Literackie, ablehnen und behaupten würde, diese Erinnerungen wären eine Gefahr für Polen. Nur die Folksshtime, deren Herausgeber Hersz Smolar war, wollte den Text veröffentlichen. Aber mein Vater wollte das nicht. Zu wenige Leser? Oder hatte er einen Groll gegen diese Zeitung, die [12]früher vom Bund herausgegeben worden war, jetzt aber nach der Pfeife der Kommunisten tanzte?
Meine Eltern waren 1946 in einem Sanatorium für Tuberkulosekranke gewesen – beide hatten sich während des Krieges mit der Krankheit angesteckt. Eines Tages war Hersz Smolar gekommen und hatte darum gebeten, Marek Edelman sprechen zu dürfen. Man hatte es ihm erlaubt, und so hatten sie – Marek, Ala und Hersz – in der Annahme, dort nicht abgehört zu werden, sich im Garten getroffen. Smolar hatte zu meinem Vater gesagt:
»Marek, du musst Polen verlassen, sie werden dich hier sonst töten …«
Mein Vater hatte daraufhin einen Moment lang geschwiegen, dann aber ruhig geantwortet:
»Nein. Weißt du, es gibt so viele Menschen, die mich töten wollten. Sie sollen es nur versuchen …«
1967. Damals hatte mein Vater seine Stelle im Krankenhaus der Medizinischen Akademie noch nicht verloren. Meine Eltern befanden sich in dem kleinen Raum, der an die Küche grenzte. Ich kam gerade von wer weiß woher und wollte mich leise in die Wohnung schleichen. Es kam selten vor, dass sie sich in diesem Vorraum aufhielten. Sie sprachen sehr laut und beachteten mich nicht. Mein Vater fragte meine Mutter: »Was meinst du? Soll ich es tun? Versucht hat das noch niemand. Der Herzchirurg hat Angst.« Meine Mutter antwortete: »Und was ist mit dem Patienten, welche Überlebenschancen hat er?« Er: »Keine, aber den Blutfluss im Herzen umzukehren ist noch nie versucht worden.« Sie: »Der Patient kann also ohne diese Operation nicht überleben?« Er: »Nein, er wird sterben. Vielleicht ist er schon tot.« Sie fragte nach, er antwortete, erklärte wieder und wieder, so als wollte er sich selbst überzeugen. »Das ist noch nie versucht worden … der Herzchirurg traut sich nicht. Wenn der Patient auf [13]dem Operationstisch stirbt, ist er als Arzt verantwortlich.« Ich betrat das Haus. Von weitem hörte ich meine Mutter ruhig sagen: »Du verschwendest Zeit, ihr müsst es tun. Geh, sag ihnen, sie sollen den Patienten für die Operation vorbereiten, und ruf [14]Professor Moll an. Ist er der Operateur?« Er ging. Ich war überrascht. Sie war sonst so unentschlossen, neigte zu Haarspaltereien … Die Operation war erfolgreich. Der Patient überlebte und lebte noch weitere zwanzig Jahre.
Die Erinnerungen wurden Ende 1967 verfasst – sicherlich während der Zeit, in der mein Vater arbeitslos war. Moczar, der damalige Innenminister, hatte sich schon seine ersten antisemitischen Ausrutscher erlaubt. Er war ein perfektes Beispiel dafür, wie Macht einen Menschen verändern kann. Derselbe Moczar hatte meinen Vater 1946 oder 1947 aufgesucht, um ihn vor Horden polnischer Antisemiten zu warnen, die Juden töten würden, und um ihm zu raten, nicht ohne Waffe auf die Straße zu gehen. 1967 machte Moczar von der Waffe des Antisemitismus Gebrauch, um an der Macht zu bleiben.
Erste Seite der Erinnerungen an das Warschauer Ghetto im ersten Notizbuch (Privatsammlung von Ania Edelman und Aleksander Edelman)
Sehr wahrscheinlich war es unsere Mutter, die unserem ohne Arbeit ziel- und antriebslosen Vater vorschlug, seine Erinnerungen an das Ghetto zu Papier zu bringen. Sie wollte ihn um jeden Preis davor bewahren, depressiv zu werden. Dasselbe hatte sie 1945 getan, indem sie ihn drängte, Das Ghetto kämpft zu schreiben. Damals hatte ihm das allerdings nicht sehr geholfen. Sie waren dann durch Europa gereist, und anschließend hatte sie ihn an der Universität eingeschrieben, damit er Medizin studierte. Dank dessen hatte er die Lethargie überwunden, die ihn nach Kriegsende befallen hatte. Der Held des Ghettos war ein Mensch wie jeder andere.
Auch diesmal war das Heilmittel nicht besonders wirksam, da die Aufzeichnungen meines Vaters von allen Verlagen abgelehnt wurden. Sie wurden zu einem bedrückenden Thema.
Es war eine schwierige Zeit, nicht nur für die beiden. Die aufkommende Welle des Antisemitismus veranlasste viele Juden, Polen zu verlassen. Das musste meinen Vater hart treffen. Einmal mehr zeigte sich, dass das Ideal des Bund, »in Frieden und [15]gegenseitigem Respekt mit den polnischen Bürgern zu leben«, nicht verwirklicht werden konnte. Die Menschen waren zerrissen, ihr Leben zerbrach, praktisch von heute auf morgen mussten sie sich entschließen, alles zu verlassen und ins Ungewisse zu gehen. Unser Haus...
| Erscheint lt. Verlag | 17.5.2024 |
|---|---|
| Übersetzer | Jens Hagestedt, Ewa Czerwiakowski |
| Vorwort | Constance Pâris De Bollardière, Aleksander Edelman |
| Verlagsort | Ditzingen |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► 20. Jahrhundert bis 1945 |
| Schlagworte | Armia Krajowa • Auflehnung • Aufstand • Auslöschung • Besatzung • Drittes Reich • Erinnerungen • Flucht • Holocaust • Judenverfolgung • Leben im Ghetto • Massenmord • Messenvernichtung • Nationalsozialismus • Polen • Schoah • Untergrund • Untergrundarmee • Warschau • Widerstand • Zeitzeuge • ZOB • Zydowska organizacja Bojowa |
| ISBN-10 | 3-15-962221-5 / 3159622215 |
| ISBN-13 | 978-3-15-962221-7 / 9783159622217 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 2,2 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich