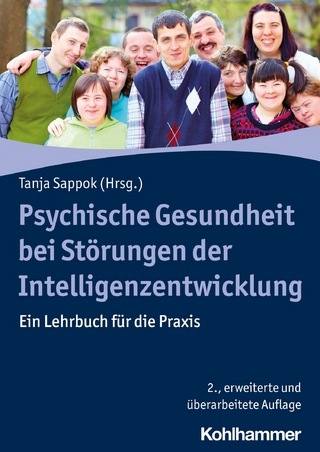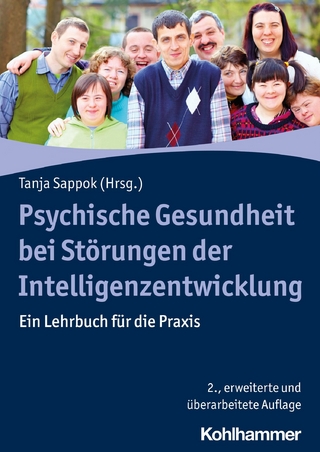Vatterode (eBook)
56 Seiten
Books on Demand (Verlag)
978-3-7597-4428-9 (ISBN)
Karl Heinz Vatterott, geb. 1946, Dr.-Ing., erlernte den Beruf des Maschinenschlossers, studierte Maschinenbau und promovierte auf dem Gebiet der Planetengetriebe. Er war viele Jahre im In- und Ausland sowi am Deutschen Patent-und Markenamt mit Fach- und Führungsverantwortung tätig. Er schrieb viele Publikationen für weltweit anerkannte Fachzeitschriften. Firmen meldeten Patente mit seinen Erfindungen an. Seine Liebe zum Familienleben ist die Triebfeder für seine umfangreichen Recherchen zum Namen "Vatterode", die in Buchform in drei Auflagen vorliegen. Ferner organisierte er die weltweiten Familientreffen 2008 und 2016 in Niederorschel.
1. Zum Familiennamen
Hören Menschen ihren eigenen, auch nur verzerrten Namen, so wird die Aufmerksamkeit auf das innere Ich gelenkt. Interesse und Wertschätzung am Menschen werden geweckt. Selbst mitten in einem angeregten Gespräch wird man durch Neugier kurzzeitig abgelenkt und überlegt: „Ist die Erwähnung meies Namens von Bedeutung, eher positiv oder negativ?“ Vorübergehend wird sogar die Konversation durch die einmalige Nennung des Namens unterbrochen, um die damit verbundene Information nicht zu überhören, sie einzuordnen und je nach deren Wert zu handeln. Dadurch ist eine Individualisierung des Menschen und der Wunsch nach Unverwechselbarkeit gegeben.
Der zur Individualisierung und Identifizierung dienende Name betrifft eine Person, einen Gegenstand, eine organisatorische Einheit oder einen Begriff. Infolge seines Einflusses auf das öffentliche Geschehen sowie seines höheren Einflusses hob sich der Adel von der gesellschaftlichen Umgebung ab. Daraus ergab sich der militärische und politische Führungsanspruch dieser Schicht. Um Landbesitz zu dokumentieren und Steuerzahlungen festzuhalten, hatte sich beim Adel im Laufe der Zeit der Familienname entwickelt. Er überträgt sich nicht einfach durch Erbgang, sondern musste als Folge der Abstammung und Zugehörigkeit des Individuums zu einer Familie:
- amtlich verbindlich sein,
- lebenslang bestehen und
- vererbt werden.
Die gehobene Stellung des Adeligen konnte unabhängig von der ursprünglichen ökonomischen Grundlage inklusive des Nachnamens vererbt werden:
- durch militärische Überlegenheit oder Leistung, Schwertadel, Rittertum,
- durch wirtschaftliche Überlegenheit, Großgrundbesitz, Patriziat,
- verliehen durch einen König oder Kaiser: Dienst- oder Amtsadel,
- aufgrund einer besonderen religiösen Rolle: Priesteradel.
Das Erbrecht des Adels beruhte auf der Agnation, d.h. dass nur männliche Nachkommen väterlicherseits erbberechtigt waren. Die Agnation ist die väterliche Gewalt über alle Familienmitglieder sowie über Hab und Gut. Eine weibliche Person durfte nur erben, wenn sie einen Adeligen heiratete.
1.1 Zur gesellschaftlichen Entwicklung in der Umgebung des Familiennamens „Vatterode“
In den vorindustriellen Hochkulturen bildete sich eine Adelsschicht. Junge noch nicht zum Ritter geschlagene Adelige wurden als Junker bezeichnet. Dieser Begriff stammt vom mittelhochdeutschen Wort „Juncherre“ ab und bezieht sich auf einen adligen Gutsbesitzer oder einen jungen Landadligen. Ab einem Mindestalter von 14 Jahren konnte ein ritterbürtiger Jüngling als Knappe oder Edelknabe Hilfsdienste leisten und das Waffenhandwerk erlernen. Bei der Erhebung zum Knappen erhielt er vom Priester ein geweihtes Kurzschwert und durfte fortan an Turnieren teilnehmen. Hatte ein Knappe das 21. Lebensjahr erreicht und sich durch Mut sowie Treue ausgezeichnet, empfing er den Ritterschlag für Langschwert und Lanze.
Der Schwertadel übernahm mit Pferden, Waffen sowie Kriegsknechten die Verteidigung der bäuerlichen Bevölkerung und wurde von ihr versorgt und ausgerüstet. Es entwickelte sich ein Vasallensystem mit Gerichtsbarkeit, in dem der Mächtigere seinen Gefolgsleuten die Mittel und Verantwortung für ihren eigenen Unterhalt übertrug. Die Welfen des Hauses Hannover gehören noch heute zu den wenigen blühenden deutschen Dynastien, die vor der ersten Jahrtausendwende nachgewiesen sind.
In Mitteleuropa war ein Angehöriger der ersten zwei Stände des Adels und des Klerus der Grundherr. Er war Grundeigentümer oder Inhaber einer Pacht mit Verfügungsgewalt über das Land und übte zumeist auch weitreichende Verwaltungsfunktionen aus, wie die Nutzungsvergabe von land- oder forstwirtschaftlichen Flächen, niedere Gerichtsfunktionen mit rechtlicher Verwaltung und er verfügte über öffentliche Befugnisse. Er besaß das Patronatsrecht und konnte in religiösen oder besitzrechtlichen Fragen über seine Untertanen bestimmen. Allerdings hatte der Grundherr Schutz und Schirm für seine Untertanen zu gewähren. Die Grundherrschaft umfasste somit eine Herrschafts- und Besitzstruktur, wie Erbuntertänigkeit, Leibherrschaft, Schutzherrschaft, Gerichtsherrschaft, Zehntherrschaft, Vogteigewalt und Dorfobrigkeit. Demnach hatte ein Adeliger als Grundherr eine Verfügungsgewalt über Personen. Diese könnte in der germanischen Gefolgschaft vor dem Mittelalter in ähnlicher Form zu finden sein. Das Prinzip des Herrschenden der damaligen Bevölkerung setzte sich durch die Christianisierung als männlich dominanter Hirte über die Schafherde und deren Verfügbarkeit durch. Die der Herde mündlich weitergegebenen Lasten veränderten sich im Laufe der Zeit schrittweise und wurden häufig erhöht, um deren Seelenheil zu dienen.
Jede Grundherrschaft hatte einen sogenannten Herrensitz. Im Mittelalter war das zumeist eine Burg, später ein Schloss oder Herrenhaus. Im frühen und hohen Mittelalter wurden die grundherrlichen Zentralhöfe oft als curtis oder curia bezeichnet. Der Herrensitz beherbergte die Familie des Inhabers der Grundherrschaft mit Verwaltern und den Bediensteten; er war zugleich der wirtschaftliche und verwaltungstechnische Mittelpunkt der Grundherrschaft. Ausgestaltungsformen des Herrensitzes waren das Allod, das Rittergut. Mit dem Rittergut waren neben den Aufgaben einer Grundherrschaft oft die niedere, in selteneren Fällen auch die Hohe Gerichtsbarkeit verbunden. Die Adeligen übten damit – bis zur Bauernbefreiung – zugleich rechtsprechende Funktionen aus und stellten außerdem die örtliche Obrigkeit mit lokaler Polizeigewalt für die Jagdgerechtigkeit, häufig Fischereirechte, Braugerechtigkeit und andere Bannrechte. Hofgüter eines Landesherrn wurden als Domänen oder Kammergüter bezeichnet. Bei größeren Grundherrschaften in einer Region mit vielen Untertanen wurde häufig ein örtlicher Meier (Verwalter) für die Verwaltung bestellt.
In der Karolingerzeit 751 bis 919 nach Chr. waren einem Herrenhof mehrere Fronhöfe oder Salhöfe zugeordnet. Diese dienten zur Verwaltung der einzelnen, oft verstreut liegenden Höfe oder Hufen des Grundherrn. Das Salland wurde in Eigenwirtschaft mit Hilfe von unfreiem Gesinde unter der Leitung eines Meiers bebaut. Zinspflichtige hörige Bauern leisteten eine festgelegte Anzahl von Tagen Frondienst, etwa Spanndienst auf dem Fronhof, und bewirtschafteten daneben ihre eigenen gegen Grundzins oder Naturalabgaben an sie vergebenen Hofstellen. Die Naturalabgaben der Hörigen spielten bis zum Ende der Grundherrschaft eine wichtige Rolle und wurden erfasst in den Salbüchern, auch als Berein bezeichnet, im Heberegister, Erdbuch, Zinsregister oder Urbar, Urbarium, Mz. Urbare oder Urbarien. Die Begriffe sind aus dem mittelhochdeutschen erbern, „hervorbringen“ oder „Ertrag bringen“ abgeleitet. Es handelt sich um zu ökonomischen, administrativen oder rechtlichen Zwecken angelegte Verzeichnisse von Liegenschaften, Abgaben und Diensten einer Grundherrschaft (z. B. eines Klosters) oder einer Villikation. Ferner gab es auch Register für Steuern der Landesherren und ab 1543 für die Türkensteuer.
Adlige Familien leisteten durch ihre Teilnahme an der Regierung, durch die Gründung von Städten, die Stiftung oder Förderung von Klöstern und Domschulen dauerhafte Beiträge zur Kultur des Mittelalters. Um die Vormacht des örtlichen Adels zu brechen setzte der König häufig Erzbischöfe und Bischöfe als Adelige von außerhalb ihrer Diözese ein.
1.2 Zur Namensgebung
Die Namensgebung ist weltweit sehr unterschiedlich geregelt und hängt von Kultur, Tradition, Gesellschaftsordnung und Herkunft ab. Die Römer hatten schon ein 3-Namen-System: Quintus Horatius Flaccus (der 5. aus der Sippe der Horatier, der Blonde) - Rufname – Sippenname – Beiname.
Beim Adel hatte sich der Familienname entwickelt, um Landbesitz zu dokumentieren und Steuerzahlungen festzuhalten. Seit der Erblichkeit der Lehen im Jahr 1037 trug der mitteleuropäische Adel für Erbansprüche feste Familiennamen; später folgten die Patrizier und Stadtbürger diesem Brauch. Um die Abgaben der Hörigen zu dokumentieren war auch für diese eine Namensgebung erforderlich. Die Namensgebung oder Gründung einer Siedlung hatte oft lange vor ihrer erstmaligen urkundlichen Erwähnung stattgefunden. Mit Hilfe der Ortsbezeichnungen blicken wir deshalb auf eine weit zurückliegende Ära ohne Dokumente in Richtung Frühgeschichte.
Im 9. Jahrhundert wurde erstmals in Venedig ein Familienname vererbt. Diese Sitte breitete sich im 12. Jahrhundert nach England sowie der Schweiz aus. Danach wurde der vererbliche Familienname auch in west- und süddeutschen Städten üblich. Für durchgängige Familiennamen bildete die Konstanzer Synode-Lustenau von 1435 eine Grundlage. Gemäß dieser wurden Kirchenbücher angeordnet. Die Anordnung wurde nur zögerlich von den Pfarrern durchgeführt. Auch konnte der Familienname noch wechseln, z. B. bei Wegzug oder aufgrund neuer...
| Erscheint lt. Verlag | 8.4.2024 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung |
| ISBN-10 | 3-7597-4428-1 / 3759744281 |
| ISBN-13 | 978-3-7597-4428-9 / 9783759744289 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 3,3 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich