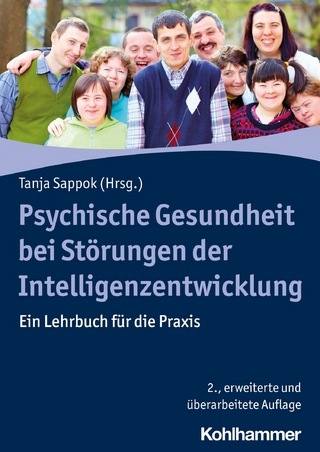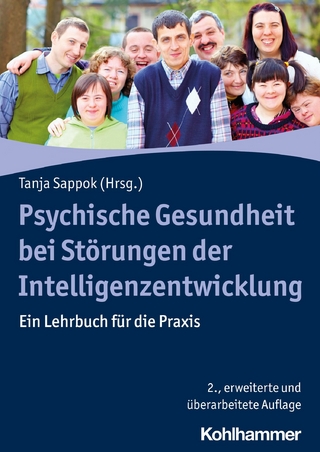Wir (eBook)
141 Seiten
Suhrkamp (Verlag)
978-3-518-78159-3 (ISBN)
Vor 75 Jahren wurde das Grundgesetz verkündet. Vor 35 Jahren fiel die Berliner Mauer. Die Bundesrepublik begeht 2024 ein doppeltes Jubiläum und kann es doch nicht mit ruhiger Selbstzufriedenheit feiern. Zu groß sind die Aufgaben, vor denen das Land steht. Internationale Krisen und Aufgaben der wirtschaftlichen Transformation setzen unsere Gesellschaft unter Stress, das Vertrauen in die Politik leidet, der Ton wird schärfer. Und extremistische Populisten stellen mit kalter Siegermiene die liberale Demokratie infrage.
In dieser kritischen Zeit erinnert der Bundespräsident an Wegmarken und Erfahrungen, die Deutschland in 75 Jahren geprägt haben. Er beleuchtet unangenehme Wahrheiten, vor allem aber die Stärken des Landes. Er wirbt für die Anstrengung gemeinschaftlichen Handelns, aus dem politische Kraft erwächst. Unser Wir ist das einer vielfältigen Gesellschaft geworden, die neu erkennen muss, was sie verbindet.
Frank-Walter Steinmeier, geboren 1956, ist seit 2017 der zwölfte Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland.
Die Möglichkeit, wir zu sagen
Wer sind wir? Diese Frage ist schwer zu beantworten. Wir können ihr nicht ausweichen und doch keine letztgültige Antwort auf sie geben. Schon als Individuen müssen wir in der Regel gründlich nachdenken und lange ausholen, um uns anderen zu erklären. Als politische Gemeinschaft, als Nation und Staat, wollen wir eine unüberschaubar große Zahl unterschiedlicher Lebensgeschichten in einem gemeinsamen Bild vereinen. Und mehr noch, nach sieben Jahrzehnten der immer engeren Verbindung mit unseren europäischen Nachbarn betrachten viele von uns sich nicht länger nur als Deutsche, sondern selbstverständlich zugleich als Europäer. Die Frage nach dem »Wir«, danach, wer wir sind und was uns als Bürgerinnen und Bürger oder als Menschen, die dauerhaft in diesem Land leben, gemeinsam ist, mag daher erst einmal Misstrauen wecken. Wer ist mit »wir« überhaupt gemeint und wer maßt sich an, darüber zu entscheiden?
Über jede autoritäre Festlegung einer nationalen Identität ist die Zeit hinweggegangen. Weder Götter und Offenbarungstexte, weder Patriarchen und Sittenwächter noch Ahnenforscher oder Identitätskonstrukteure können uns zu- oder vorschreiben, wer wir zu sein haben. Zu unserem Glück, möchte man gleich hinzufügen. Aber noch immer gibt es politische Kräfte, die nationale Homogenität herbeiwünschen und sich davon die Lösung unserer Probleme versprechen. Einige unter ihnen wollen eine solche Homogenität sogar gewaltsam herstellen und Deutsche ausbürgern, die für sie nicht ins Bild passen. Gegen solche verfassungsfeindlichen Phantasmen stellt sich die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger.
Wenn es jemals so etwas gab wie eine geschlossene Herkunftsgemeinschaft, die Wesenszüge teilte und überlieferte und darauf ihre Institutionen gründete, wenn es jemals möglich war, schon vor jeder politischen Verständigung die religiöse, kulturelle, ethnische »Substanz« einer Gemeinschaft zu bestimmen, dann ist diese Epoche der Menschheitsgeschichte vorbei. Im 21. Jahrhundert existieren keine völlig homogenen Nationalstaaten mehr. Vermutlich hat es sie nie gegeben. Politischer Realismus führt uns zur Anerkennung der Tatsache, dass unsere Gesellschaft, wie andere Gesellschaften auch, durch die Vielfalt der Herkunftsgeschichten geprägt ist, durch verschiedene Bekenntnisse, Orientierungen, Lebensweisen. Verschiedenheit ist das Signum moderner Gesellschaften. Realismus kann uns also lehren, die Dinge so zu sehen, wie sie sind, und die Eigenheiten sowie die abweichenden Haltungen von anderen Menschen in unserer Nähe zu akzeptieren, solange sie sich friedlich äußern.
Es gibt aber noch einen viel wichtigeren Grund, diese Akzeptanz einzuüben. Wir nehmen die Freiheit, die zur Vielfalt führt, nicht einfach nur hin. Wir haben sie zum Grundstein unserer politischen Ordnung erklärt. Wir haben vor 75Jahren das Grundgesetz beschlossen und die Freiheit zum Herzstück unserer Verfassung gemacht. Wir haben uns vor 35Jahren von der SED-Diktatur befreit. Wir wollen in Freiheit leben. Wir wollen, dass alle Bürgerinnen und Bürger sich frei und gleichberechtigt entfalten und ihr Glück finden können. Solche, die in unsere politische Ordnung hineingeboren wurden, ganz genauso wie diejenigen, die in sie eingewandert, die in ihr heimisch, die durch die Wahl einer neuen Staatsangehörigkeit Deutsche geworden sind. Unsere Frage, wer wir sind, sollten wir also beherzt nach dem Leitstern demokratischer Freiheit zu beantworten versuchen, und das bedeutet, alle Deutschen haben ein Mitspracherecht, wenn wir sie diskutieren, verhandeln und klären.
Ich sage: »Wir haben vor 75Jahren das Grundgesetz beschlossen«, obwohl weder ich selbst noch irgendein lebender Zeitgenosse im Konvent von Herrenchiemsee gesessen und im Parlamentarischen Rat debattiert hat. Es leben noch Zeugen, die heute Mitte neunzig sind und die am 14. August 1949 bei der ersten Bundestagswahl ihre Stimme abgegeben haben. Aber auch diese Erstwählerinnen und -wähler der Bundesrepublik sind es nicht allein, die sagen können: »Wir haben diese Republik begründet und errichtet.« Die Nachgeborenen der folgenden Jahrzehnte, die Eingewanderten, ob als Arbeitskräfte geworben oder als Kriegsflüchtlinge aufgenommen, ihre Kinder und Enkel, und diejenigen, die erst noch auf die Welt kommen, können sich diesem Wir anschließen. Und natürlich erst recht all diejenigen unter uns, die in der DDR gelebt haben und dort ihren Alltag hatten, die vielen, die sich damals nach mehr Freiheit sehnten, die aus der Diktatur flohen, von ihr ausgebürgert wurden, alle, die gegen sie opponierten, die vor 35Jahren in Plauen, in Leipzig, auf dem Berliner Alexanderplatz demonstrierten, alle, die den schweren Entschluss zur Ausreise fassten, in Ungarn, in Prag den Weg in die Freiheit suchten, alle, die in der wunderbaren Nacht des 9. November 1989 an der Bornholmer Straße die Mauer und damit die Diktatur der SED zum Einsturz brachten, alle, die nach der Wiedervereinigung Deutschlands am Neuanfang mitwirkten. Nicht nur einige wenige, sondern sie alle können sagen: »Wir haben die Freiheit errungen und die Gleichberechtigung aller zum Grundgesetz unserer Bundesrepublik gemacht.«
Vom Nachdenken darüber und vom Entschluss, in einem historisch-politischen Sinne »wir« sagen zu können, davon handeln die nachfolgenden Seiten. Was demografisch gegenwartsbezogen absurd erscheint, ist in einem politisch normativen Sinne sehr gut möglich und sogar erforderlich: Unser politisches »Wir« ist mehr als die nachzählbare Summe aller gegenwärtig in Deutschland lebenden Menschen. Zwar können nur wir Zeitgenossen heute Verantwortung tragen, entscheiden und handeln. Aber unsere Verpflichtung gilt nicht allein dem Jetzt. Als Bürgerinnen und Bürger einer politischen Gemeinschaft reisen wir in der Zeit. Wir bezeugen Auschwitz. Wir bekennen uns zum Neuanfang des Grundgesetzes und der Grundrechte als Antwort auf die beispiellosen Verbrechen des Nazi-Regimes. Wir wissen, was es bedeutet, die Demokratie in Deutschland nach dem Scheitern von Weimar endlich erreicht zu haben. Wir denken daran, dass wir nach zerstörerischen Kriegen den Frieden gewonnen haben, der uns in die Europäische Union geführt hat. Wir erinnern das Jahr 1989 und fühlen uns im Glück verbunden, die kommunistische Diktatur überwunden zu haben, ganz gleich, ob wir selbst dabei waren oder nicht, als die Mauer fiel. Wir blicken gemeinsam in die Zukunft, ob wir sie selbst erleben werden oder erst unsere Kinder. Kurzum, es ist möglich, »wir« zu sagen.
Ich habe diese Gedanken aus Anlass eines doppelten Jubiläums niedergeschrieben, des 75. Gründungsjahrs der Bundesrepublik und des 35. Jahrestags der friedlichen Revolution – im Bewusstsein also, dass wir in Ost und West schon bald die Hälfte des bisherigen Weges unserer Republik zusammen gegangen sind. Ein Staatsjubiläum allein wäre freilich ein sehr äußerlicher Grund, um nach unserem Selbstverständnis zu fragen. Es wäre Routine. Feierlich, würdig und zugleich erwartbar. Das Selbstlob einer in sich ruhenden Nation. Aber gerade die abgeklärte Selbstgewissheit, mit der wir noch vor einigen Jahren die Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland gefeiert haben, ist verschwunden. Es gibt also einen anderen, einen inneren Anstoß, den Blick auf die großen demokratischen Zäsuren von 1949 und 1989 zu werfen, denn unser Land begeht beide Jahrestage zweifellos in einer kritischen Zeit, in der es sich seiner selbst unsicher geworden ist. Einer Zeit, in der nun mehr als zwei Jahre Krieg in der Ukraine herrscht, in der grausamer Terrorismus und ein opferreicher Krieg im Nahen Osten auch uns herausfordern, Stellung zu beziehen. Einer Zeit, in der die liberale Demokratie, manchmal aggressiv, oft verlogen und von einigen Rechtspopulisten gar mit kalter Siegermiene angegriffen wird, die böse Erinnerungen wachruft. Einer Zeit, in der unser Wohlstandsmodell herausgefordert wird. Wann genau uns der Optimismus, der nach dem Kalten Krieg herrschte, entglitten ist, wann die Erschöpfung angesichts immer neuer Umbrüche überhandgenommen hat und warum die Zweifel gewachsen sind, lässt sich gar nicht so einfach bestimmen. Es gibt dafür nicht eine einzelne Ursache und keine einzelnen Urheber. Und der Trend betrifft nicht nur uns, wir beobachten ihn in allen westlichen...
| Erscheint lt. Verlag | 22.4.2024 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung |
| ISBN-10 | 3-518-78159-6 / 3518781596 |
| ISBN-13 | 978-3-518-78159-3 / 9783518781593 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,2 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich