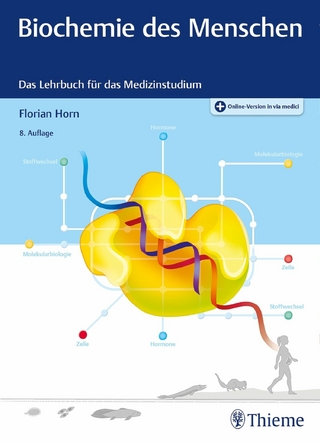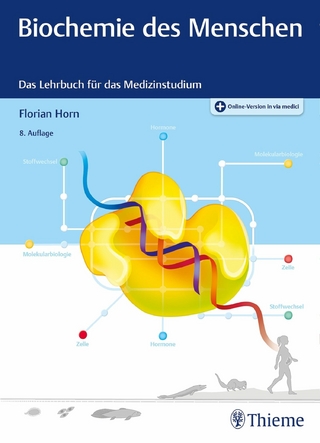Handbuch Psychoaktive Substanzen (eBook)
XVIII, 713 Seiten
Springer Berlin (Verlag)
978-3-642-55125-3 (ISBN)
Das Handbuch Psychoaktive Substanzen bietet einen fundierten Überblick und vereint das aktuelle Grundlagenwissen einer neu entstehenden Drogenwissenschaft, die psychoaktive Substanzen mehrdimensional betrachtet, Chancen und Risiken bilanziert und gegenwärtige Debatten mit Fakten fundiert. Das Handbuch ist ein wichtiges Referenzdokument für verschiedene Disziplinen und Professionen; von Medizinern, Psychologen, Suchttherapeuten, Pharmakologen und Neurowissenschaftlern zu Sozialwissenschaftlern, (Sozial-)Pädagogen, Kriminologen, Juristen und Polizisten. Es ist außerdem für jene Personen von Interesse, die sich mit den soziokulturellen und historischen Aspekten des Ge- und Missbrauchs von psychoaktiven Substanzen beschäftigen - einschließlich Lehrern, Journalisten und Politikern. Basierend auf einem interdisziplinären Ansatz wird in den Kapiteln das komplexe Wirkungsgefüge zwischen Mensch und psychoaktiven Substanzen untersucht und in strukturierter und übersichtlicher Weise zugänglich gemacht. Aktuelle Entwicklungen wie das Erscheinen neuer psychoaktiver Substanzen (NPS) sowie die kulturellen und politischen Veränderungen der letzten Jahre werden ebenfalls beleuchtet.
The Handbook of Psychoactive Substances integrates the current knowledge base of the evolving field of drug science that views psychoactive substances from an interdisciplinary perspective. Opportunities and risks are balanced alongside objective facts in order to add to current debates. The Handbook is an important reference document, with relevance to many disciplines and professions; from medical doctors, psychologists, addiction therapists, pharmacologists and neuroscientists to criminologists, police officers, lawyers and attorneys. It will also be of interest to those involved in the socio-cultural and historical aspects of drug use and misuse, including teachers, journalists and politicians. In a helpful structured form the handbook offers user-friendly and trustworthy information concerning classes of psychoactive substances. Chapters explore psychoactive drugs as therapeutic tools, their benefits for medicine and research and the problems associated with their harmful use. Current developments, including the recent appearance of Novel Psychoactive Substances (NPS) and the associated political and cultural changes in recent years are also explored in the book.
Maximilian von Heyden ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am FINDER Institut für Präventionsforschung und dem Institut für Sexualwissenschaft und Sexualmedizin der Charité – Universitätsmedizin Berlin mit gesundheitswissenschaftlichem Schwerpunkt.Dr. sc. hum. Henrik Jungaberle ist Präventions- und Drogenforscher am FINDER Institut für Präventionsforschung und hat am Universitätsklinikum Heidelberg EU- und DFG-Projekte zu psychoaktiven Substanzen geleitet. Er ist Gründer von MIND – European Foundation for Psychedelic Science.Dr. med. Tomislav Majić ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Leiter der AG Psychotrope Substanzen an der Psychiatrischen Abteilung der Charité – Universitätsmedizin Berlin im St. Hedwig Krankenhaus.
Handbuch Psychoaktive Substanzen 4
Teil I: Einleitung 17
Einführung: Auf dem Weg zu einer transdisziplinären Drug Science 18
1 Vorgehen bei der Edition des Handbuchs 22
Literatur 22
Teil II: Geschichte, Gesellschaft und Kultur 24
Doppelte Kulturgeschichte des Rauschs 25
1 Klassische Erzählungen zum Rausch 25
2 Rausch als Trick der Vernunft 27
3 Passagen der Rauschgeschichte 30
Literatur 35
Drogen und Rausch in der deutschsprachigen Literatur 37
1 Frühe literarische Beschäftigung mit dem Rausch 37
2 Anfänge einer deutschsprachigen Drogenliteratur 38
3 Zwischenkriegszeit 40
4 Nachkriegszeit 42
5 60er- und 70er-Jahre 43
6 80er-Jahre bis zur Gegenwart 45
Literatur 46
Sozialwissenschaftliche Perspektiven auf Drogen und Sucht 47
1 Drogenkonsum als soziale und kulturelle Praxis 48
2 Sucht als historisch und kulturell wandelbares Konzept 49
3 Sucht als kulturelle Praxis 51
4 Fazit: Doing drugs, doing addiction 53
Literatur 54
Gender und psychoaktive Substanzen 55
1 Einleitung 55
2 Geschlechtsspezifische Ursachen, Verlaufs- und Beendigungsformen 56
3 Warum gibt es so viele Jungen/Männer, die substanzbezogene Störungen aufweisen? 57
4 Exkurs: Drogen machen Sinn – auch zur Konstruktion von Geschlechtsidentität 58
5 Wie gendersensibel arbeitet die Suchtkrankenhilfe? 60
Literatur 61
Medizinische Stigmatisierung von Drogenkonsumenten aus historischer Perspektive 64
1 Die Ambivalenz der Sucht zwischen Krankheit und Moral 64
2 Der Süchtige – ein medizinisches Mängelwesen 67
3 Abweichendes Verhalten als Folge des Konsums psychoaktiver Substanzen 73
Literatur 78
Drogenmündigkeit: Von der Suchtprävention zur Drogenerziehung 81
1 Drogenmündigkeit: Von der Suchtprävention zur Drogenerziehung! 82
2 Geburtsort Medizin: Das moderne Bild vom „Drogenkonsum`` 82
3 Der binäre Code „Abstinenz versus Abhängigkeit`` 84
4 Problematische Verkürzungen: Substanzfixierung oder Wer trinkt schon gern C2H5OH? 85
5 „Die sind doch alle krank``: Durch Pathologisierung zu krankmachenden Konsummustern 85
6 „(Keine) Macht den Drogen``: Dämonisierung und Bemächtigungsmythos 87
7 Der Gestaltungsspielraum von Drogenkonsum 88
8 Der Umgang mit psychoaktiven Substanzen: Nicht banal und voller Herausforderungen 89
9 Der Paradigmenwechsel: Drogenmündigkeit 90
10 „Drogenmündigkeit`` und demokratisch-emanzipatorische Grundüberzeugungen 92
Literatur 93
Geschichte der Psychedelika in der Medizin 95
1 Einleitung 95
2 Die Geschichte der Psychedelika in der Medizin 96
2.1 Vom Mittelalter bis zur industriellen Revolution 96
2.2 Die 1890er-Jahre 96
2.3 1900-1920 97
2.4 Die 1930er-Jahre 97
2.5 Die 1940er-Jahre 97
2.6 Die 1950er-Jahre 98
2.7 Die 1960er-Jahre 100
2.8 1970-1975 102
2.9 1975-1980 102
2.10 Die 1980er-Jahre 103
2.11 Die 1990er-Jahre 104
2.12 Die 2000er-Jahre 106
2.13 Seit dem Jahr 2010 108
3 Fazit 110
Literatur 110
Teil III: Politik und Recht 117
Gesetzliche Kontrolle psychoaktiver Substanzen in Europa 118
1 Entwicklung eines internationalen Kontrollsystems 119
2 Die Kontrolle psychoaktiver Substanzen innerhalb der Europäischen Union 121
3 Das Tempo des Wandels 124
4 Genehmigung des nicht-medizinischen Gebrauchs psychoaktiver Substanzen in Europa 129
5 Schlussfolgerungen 130
Literatur 131
Systematik und Kritik des deutschen Betäubungsmittelrechts und dessen Weiterentwicklung 132
1 Einführung 132
2 Strafrechtstheorie und Verfassung 133
2.1 Drogenumgang verletzt kein Rechtsgut 133
2.2 Recht auf Rausch 135
3 Verstoß gegen das Verhältnismäßigkeitsprinzip 136
3.1 Keine Geeignetheit des Betäubungsmittelstrafrechts 136
3.1.1 Scheitern der Generalprävention 136
3.1.2 Unzutreffende empirische Schadensbehauptungen 137
3.1.3 Unbeabsichtigte Nebenwirkungen der Drogenprohibition 139
3.1.4 Globale Kollateralschäden 140
3.2 Keine Erforderlichkeit zur Bekämpfung von Gesundheitsgefahren 140
3.2.1 Zweckmäßigere Alternativen 141
3.2.2 Faktische Feldexperimente mit (Quasi-)Legalisierung 141
3.2.3 Psychologische Forschung zur Wirkung von Gesetzen 143
3.3 Keine Proportionalität – Verhältnismäßigkeitsprüfung im engeren Sinne 143
3.4 Fazit: Rechtliche, soziale und ökonomische Irrationalität der Prohibition 144
Literatur 145
Drogenkleinhandel und Social Supply 147
1 Einleitung Drogenkleinhandel: Zu den Strukturen der Distribution illegaler Drogen 147
2 Drogenkleinhandel: Erwerbssituationen 149
3 Drogenkleinhandel: Weitergabesituationen und ‚Dealerkarrieren` 150
4 Drogenkleinhandel in der ‚offenen` Szene 153
5 Drogenkleinhandel: Straßenhandel außerhalb ‚offener` Szenen 154
6 Drogenhandel im Internet 154
7 Drogenkleinhandel: Zusammenfassung und Diskussion 157
Literatur 158
Teil IV: Methodik und konzeptionelle Fragen 161
Empirische Untersuchung veränderter Bewusstseinszustände 162
1 Wann spricht man von einem veränderten Bewusstseinszustand? 163
2 Eine grobe Unterteilung von Bewusstseinszuständen 164
3 Herausforderungen bei der Quantifizierung von Bewusstseinszuständen 165
4 Quantifizierung von Veränderungen im Wachbewusstsein 166
4.1 Psychometrische Instrumente 167
4.1.1 Fragebögen zur Erfassung eines akuten ASCs (State) 167
4.1.2 Fragebögen zum Auftreten von ASCs (Trait) 171
4.1.3 Diskussion und Einordnung 172
4.2 Physiologische Messmethoden 173
5 Forschungsperspektiven 176
5.1 Neurowissenschaftliche Untersuchungen 176
5.2 Phenomenoconnectomics 177
Literatur 177
Teil V: Konsummuster und Gebrauchskontexte 181
Salutogene und nicht-pathologische Formen von Substanzkonsum 182
1 Einleitung 183
2 Fragestellung 185
3 Methode 185
4 Ergebnisse der Literaturrecherche 185
4.1 Begriffe für positive oder neutrale Gebrauchsformen psychoaktiver Substanzen im wissenschaftlichen Diskurs – und einige Antonyme oder Negationen 185
4.1.1 International gebräuchliche Terminologien im Feld des Substanzgebrauchs 186
4.1.2 Medizinischer Gebrauch, therapeutischer Gebrauch, Selbstmedikation 186
4.1.3 Rekreationaler Drogengebrauch/recreational use 188
4.1.4 (Nicht-)Problematischer, riskanter und gefährlicher Gebrauch/problematic use 188
4.1.5 Missbrauch und abhängiger bzw. süchtiger Gebrauch/misuse and abuse 189
4.1.6 Instrumenteller Gebrauch/instrumental use 190
4.1.7 (Nicht-)Kompulsiver Gebrauch/compulsive use 190
4.1.8 Vergnügen und Pleasure als Bestimmungsmerkmal von Substanzkonsum 191
4.1.9 Hedonistischer Gebrauch/hedonistic use 191
4.1.10 Funktionaler Gebrauch/functional use 192
4.1.11 Kontrollierter Gebrauch/controlled use 192
4.1.12 (Nicht-)Pathologischer Gebrauch/pathological use 193
4.1.13 Komorbidität im Zusammenhang mit Substanzkonsum 193
4.1.14 Mündiger und verantwortlicher Gebrauch/mature and responsible use 193
4.2 Begriffe für positive, neutrale und negative Gebrauchsformen im institutionellen Diskurs sowie deren Antonyme 194
4.2.1 Annual Reports des International Narcotics Control Boards (INCB) 194
4.2.2 „Europäische Drogenberichte – Trends und Entwicklungen`` der EMCDDA 194
4.2.3 National Institute of Drug Abuse 194
4.2.4 „Annual Reports`` des United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) 195
4.3 Weitere Begriffe für positive und neutrale Konsumformen im öffentlichen Diskurs sowie deren Antonyme 195
4.3.1 Gelungener Drogenkonsum/successful drug use 195
4.3.2 Risikoarmer Drogengebrauch/low risk use 195
4.3.3 Geglückter Drogenkonsum 196
4.3.4 Unschädlicher Drogengebrauch/harmless drug use 196
5 Schlussfolgerungen 197
5.1 Zusammenfassung wissenschaftlicher Konzepte, die für nicht-pathologische Konsumformen herangezogen werden 197
5.2 Die Stellung von Gesundheitsforschung im Rahmen einer interdisziplinären Drug Science 198
5.3 Aufgaben und Untersuchungsbereiche einer Drogengesundheitsforschung 199
5.3.1 Verbesserung oder Ermöglichung sozialer Interaktion 199
5.3.2 Erleichterung und Verbesserungen des Sexualverhaltens 200
5.3.3 Leistungssteigerung (Enhancement) 200
5.3.4 Erholung von biopsychosozialem Stress 200
5.3.5 Selbstmedikation psychischer Probleme 200
5.3.6 Erweiterung des menschlichen Neugierverhaltens und der Kreativität 200
5.3.7 Lebenszufriedenheit und Well-Being 201
5.4 Abschließende Überlegungen 201
Literatur 201
Konsummusterforschung zu psychoaktiven Substanzen 204
1 Einleitung 204
2 Begriffsklärungen 205
3 Weniger risikozentrierte Sichtweisen 207
Literatur 211
Sucht, Abhängigkeit und schädlicher Gebrauch 213
1 Einleitung 213
2 Definition und Klassifikation von Substanzmissbrauch und Abhängigkeit 214
3 Ursachen und Erklärungsansätze von Substanzmissbrauch und Abhängigkeit 216
Literatur 220
Neue psychoaktive Substanzen: Konsummuster, Konsummotive, Nebenwirkungen und problematischer Konsum 222
1 Einleitung 223
2 Konsummuster 225
2.1 Generelle Charakteristika von NPS-Konsumierenden 225
2.1.1 Exkurs: Regionale Schwerpunkte des NPS-Konsums in Deutschland 227
2.1.2 Häufiger und intensiver Konsum 228
3 Wahrgenommene Nebenwirkungen und Risiken des NPS-Konsums 229
3.1 Akute Nebenwirkungen und Überdosierungen 229
3.2 Folgeprobleme des NPS-Konsums 230
4 Fazit 231
Literatur 232
Pharmakologisches Neuroenhancement 234
1 Pharmakologisches Neuro-Enhancement – ein neues Verständnis 235
2 Das Dilemma der Definition des Pharmakologischen Neuro-Enhancements 236
3 Verbreitung, Kontext und Prädiktoren für Pharmakologisches Neuro-Enhancement 237
4 Welche Substanzen sind unter welchen Bedingungen wirksame Neuroenhancer? 240
4.1 Wirksamkeit von psychoaktiven Substanzen zur kognitiven Leistungssteigerung 240
4.2 Persönlichkeit 241
5 Die bioethische Debatte und Einstellungen zum pharmakologischen Neuro-Enhancement 242
5.1 Medizinische Sicherheit 242
5.2 Fairness 242
5.3 Zwang zur Einnahme von Neuron-Enhancern 243
6 Zukünftige Zunahme des Substanzkonsums zur Leistungssteigerung im Studium und am Arbeitsplatz? 243
Literatur 244
Psychoaktive Substanzen im Alter 247
1 Einleitung 247
2 Alkohol im Alter 249
2.1 Epidemiologie 249
2.2 Besonderheiten des Konsums 250
2.3 Folgen des Konsums 251
2.4 Interventionsmöglichkeiten 251
3 Benzodiazepine im Alter 253
3.1 Epidemiologie 253
3.2 Besonderheiten des Konsums 254
3.3 Folgen des Konsums 254
3.4 Interventionsmöglichkeiten 255
4 Opioide im Alter 256
4.1 Opioid-Analgetika im Alter 256
4.2 Heroinkonsum im Alter 258
5 Einfluss von Altersbildern auf Konsumenten und Behandler 260
6 Fazit 262
Literatur 262
Epidemiologie des Konsums von neuen psychoaktiven Substanzen 266
1 Einleitung 267
2 Datenerhebungen in Zufallsstichproben 268
2.1 Studien mit Jugendlichen und Schülern 268
2.2 Allgemeine Bevölkerungsumfragen 271
3 Erhebungen auf der Grundlage von Ermessensstichproben 274
4 Weitere Methoden und nationale Monitoring-Systeme 277
5 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 279
Literatur 280
Teil VI: Prävention 282
Suchtpräventive Ansätze: eine transnationale Perspektive 283
1 Einleitung 284
2 Die Problemlage 1 – wenig Daten 285
3 Die Problemlage 2 – Fehlannahmen in der Prävention 287
4 Inhalte von Präventionsmaßnahmen: worin bestehen sie? 292
5 Welche Ansätze lassen sich auch bei neuen Trends einsetzen? 294
6 Einsatzbereiche von Präventionsmaßnahmen 295
7 Ausblicke für die Prävention in Europa 300
Literatur 302
Qualität in der Suchtprävention: Was können Qualitätsstandards leisten? 309
1 Qualität in der Suchtprävention 310
1.1 Qualitativ hochwertige Präventionsarbeit – eine Selbstverständlichkeit? 310
1.2 Was bedeutet Qualität in Bezug auf Suchtprävention? 312
2 Qualitätsstandards für die Suchtprävention 314
2.1 Drei Typen von Qualitätsstandards für die Suchtprävention 314
2.2 Wie entstehen Qualitätsstandards für die Suchtprävention? 315
2.3 Konkrete Beispiele für Qualitätsstandards in der Suchtprävention 316
3 Welchen Beitrag können Qualitätsstandards für die Suchtprävention leisten? 318
3.1 Was Qualitätsstandards in der Suchtprävention bewirken sollen 318
3.2 Praktische Anwendungsmöglichkeiten für Qualitätsstandards in der Suchtprävention 320
4 Die Umsetzung von Qualitätsstandards in der Praxis der Suchtprävention 322
4.1 Herausforderungen bei der Anwendung und Umsetzung von Qualitätsstandards 322
4.2 Die Umsetzung von Qualitätsstandards erfordert den Blick auf das System der Prävention 324
5 Zusammenfassung und Ausblick 325
Literatur 327
Drug Checking und Aufklärung vor Ort in der niedrigschwelligen Präventionsarbeit 329
1 Einleitung 330
2 Prävalenzen und mögliche gesundheitliche Risiken im Zusammenhang mit dem Konsum von illegalen psychoaktiven Substanzen 331
3 Begriffsklärung Drug Checking 331
4 Integriertes Drug Checking (IDC) am Beispiel von checkit! 332
4.1 Organisation, Vorbereitung und Ablauf eines Event-Einsatzes 332
4.2 Abgabe von Substanzproben 333
4.3 Präsentation und Besprechung der Analyseergebnisse 333
5 Analytisch-Chemische Aspekte des Drug Checking 334
5.1 Grundsätzliche Anforderungen und Zielsetzung beim mobilen DC 334
5.2 Strategische Ansätze und apparative Umsetzung eines mobilen DC 334
5.3 Mobiles Drug Checkingam Beispiel von checkit! 336
6 Nutzen von Drug Checking 336
6.1 Bedeutung von Drug Checking für (potenzielle) Konsumenten/innen 336
6.2 Bedeutung von Drug Checkingfür Prävention und Öffentlichkeit 338
Literatur 339
Teil VII: Pharmakologische Grundlagen 341
Pharmakologische Grundlagen: Das Schicksal psychoaktiver Substanzen im menschlichen Körper 342
1 Pharmakologische Grundlagen der Wirkung psychoaktiver Substanzen 342
2 Pharmakokinetik: Das Schicksal von Substanzen im menschlichen Körper 343
2.1 Verteilung (Distribution) 343
2.2 Elimination 346
2.3 Abhängigkeit vom Applikationsweg, Absorption 352
2.4 Nicht-lineare Pharmakokinetik 360
Literatur 362
Pharmakologische Grundlagen: Mechanismen und Variabilität der Wirkung psychoaktiver Substanzen 366
1 Pharmakodynamik: Molekulare Mechanismen der Substanzwirkung 366
1.1 Zielstrukturen von Arzneimitteln/Substanzen 367
1.2 Exposition – Effekt 369
2 Transmittersysteme 371
2.1 Neurotransmission 371
2.2 Opioidsystem 380
2.3 Endocannabinoid-System 380
3 Variabilität 381
3.1 Pharmakogenetik 382
3.2 Krankheiten 384
3.3 Wechselwirkungen: Einfluss von Medikamenten und Mischkonsum 384
Literatur 386
Pharmakologie und Toxikologie synthetischer Cannabinoidrezeptor-Agonisten 389
1 Einleitung 389
2 Klassifizierung 390
3 Pharmakologie und Toxikologie 392
Literatur 404
Endogene Cannabinoide und das Endocannabinoidsystem 410
1 Einleitung 410
2 Erste Schritte der Erforschung des Endocannabinoidsystems 411
3 Cannabinoidrezeptoren 411
3.1 Der Cannabinoid-1-Rezeptor 411
3.2 Die Schutzfunktion des CB1-Rezeptors 412
3.3 Der Cannabinoid-2-Rezeptor 412
4 Funktionsweise der Endocannabinoide 413
5 Synthese und Abbau der Endocannabinoide 414
6 Weniger gut erforschte Endocannabinoide 415
7 Funktionen der Endocannabinoide 415
7.1 Funktionen der Endocannabinoide im Gehirn 415
7.2 Funktion der Endocannabinoide im Herzkreislaufsystem 416
7.3 Funktion der Endocannabinoide im Magen-Darm-Trakt 416
7.4 Funktion der Endocannabinoide in der Leber 416
7.5 Funktion der Endocannabinoide im Immunsystem 416
7.6 Funktion der Endocannabinoide in der Muskulatur 417
7.7 Funktion der Endocannabinoide in den Knochen 417
7.8 Funktion der Endocannabinoide bei der Reproduktion 417
7.9 Funktion der Endocannabinoide in der Haut 418
Literatur 418
Teil VIII: Biologische Grundlagen 420
Neurobiologische Grundlagen der Wirkung von Psychedelika 421
1 Einteilung der Halluzinogene und chemische Struktur 422
2 Interaktion mit dem Serotonin Rezeptor System 422
3 Funktionelle Selektivität am Serotonin 5-HT2A Rezeptor System 424
4 Interaktion mit dem Glutamat und Dopamin System 425
5 Grundlagen der Wirkung von Psychedelika auf die visuelle Wahrnehmung 427
6 Grundlagen der Wirkung von Psychedelika auf die emotionale und soziale Verarbeitung 427
7 Grundlagen der Wirkung von Psychedelika auf die Selbstwahrnehmung 428
8 Neurobiologische Modelle der durch Psychedelika ausgelösten veränderten Bewusstseinszustände 429
Literatur 431
Die Rolle von psychoaktiven Substanzen bei Lern- und Anpassungsprozessen 435
1 Die Bedeutung von Emotionen bei Anpassungsvorgängen 436
2 Assoziatives Lernen, prediction error, free-choice Paradigma 438
3 Trennungsschmerz und Analogie von physischem und psychischem Schmerz 440
4 Palliativer oder integrativer Gebrauch von psychoaktiven Substanzen 442
5 Substanzgestützte Reconsolidation und Reprocessing: Perspektiven für affekt-zentrierte Psychotherapie 445
Literatur 448
Teil IX: Psychiatrische und suchtmedizinische Aspekte 450
Die Behandlung von Suchterkrankungen in Deutschland 451
1 Einleitung 451
2 Suchthilfesystem am Beispiel Deutschland 452
3 Therapieprogramme, Behandlungsansätze, Richt- und Leitlinien 453
4 Besondere Herausforderungen: Motivation, Zielvereinbarungen und Komorbidität 455
Literatur 457
Psychodynamik des Rauschs und der Sucht 459
1 Einleitung und Begriffsbestimmung 459
2 Zum Verhältnis zwischen Kreativität, Rausch und Sucht 460
3 Psychoanalytische Modelle der Suchtdynamik 464
3.1 Triebtheoretische Modelle 464
3.2 Narzissmustheoretische Ansätze 467
3.3 Ich-psychologische Ansätze der Suchtdynamik 467
3.4 Objektbeziehungstheoretische Aspekte 469
Literatur 471
Flashbacks und anhaltende Wahrnehmungsstörungen nach Einnahme von serotonergen Halluzinogenen 473
1 Einleitung 473
2 Symptomatologie 476
3 Diagnose und Differenzialdiagnose 476
4 Epidemiologie 477
5 Ätiopathogenese 478
6 Therapie 478
7 Zusammenfassung 479
Anhang 479
Literatur 480
Therapie der Cannabisabhängigkeit 483
1 Einleitung 483
2 Cannabisbezogene Störungen 484
3 Diagnostik cannabisbezogener Störungen 486
4 Beratungs- und Frühinterventionsansätze bei Cannabismissbrauch 487
5 Behandlung der Cannabisabhängigkeit 489
6 Evidenzbasierte Behandlungsansätze und Praxisalltag 490
7 Fazit 491
Literatur 491
Therapie der Alkoholabhängigkeit 493
1 Vorbemerkung 493
2 Der spezifische Behandlungsrahmen in der Therapie der Alkoholabhängigkeit 494
2.1 Entzugsbehandlung innerhalb der Akutversorgung 494
2.2 Entwöhnungsbehandlung als medizinische Rehabilitationsmaßnahme 494
2.3 Nachsorgemaßnahmen 494
3 Spezifische Grundprinzipien der Therapie der Alkoholabhängigkeit 495
3.1 Eingeschränkte Wahlmöglichkeiten hinsichtlich des Therapieziels 495
3.2 Motivationspsychologische Niedrigschwelligkeit anstelle von Konfrontation 496
3.3 Beachtung von psychischer Komorbidität und Alkoholfolgeschäden bei der Behandlungsplanung 496
3.4 Beachtung subkortikaler Prozesse und eingeschränkter Willensfreiheit der Betroffenen 497
3.5 Zukunftsorientierung der Behandlung 497
4 Anamneseerhebung, Diagnostik und Differentialdiagnostik 497
5 Behandlungsverfahren in der Therapie der Alkoholabhängigkeit 498
5.1 Strukturierung der Therapiesitzungen 498
5.1.1 Strukturierung der Einzeltherapiesitzungen 500
5.1.2 Strukturierung der Gruppentherapiesitzungen 501
5.2 Motivationial Interviewing zur Entwicklung von Änderungsbereitschaft 501
5.3 Informationsvermittlung und Auseinandersetzung mit der eigenen Abhängigkeitsentwicklung 502
5.4 Erarbeiten eines individuellen Störungsmodells 504
5.5 Stellenwert komorbider Störungen 505
5.6 Rückfallprävention 507
6 Der Einbezug von Angehörigen 508
7 Therapeutischer Umgang mit Rückfällen während der Behandlung 509
Literatur 509
Teil X: Psychoaktive Substanzen 511
Stimulanzien 512
1 Einleitung 513
1.1 Geschichte 513
1.2 Subgruppen der Stimulanzien 514
1.2.1 Klassische Psychostimulanzien, Kokain und funktionelle Analoga 514
1.2.2 Cholinergika 515
1.2.3 Methylxanthine 515
1.2.4 Entaktogene (Empathogene) 515
2 Klassische Psychostimulanzien, Kokain und dessen funktionelle Analoga 516
2.1 Überblick 516
2.2 Stammverbindungen und Leitsubstanz klassischer Psychostimulanzien 517
2.3 Einsatz von Psychostimulanzien in der Pharmakotherapie 519
2.3.1 Kokain 519
2.3.2 Amphetamin und Methamphetamin 519
2.3.3 Methylphenidat 520
2.3.4 Modafinil 521
2.3.5 Atomoxetin 521
2.4 Militärische Nutzung 522
2.5 Leistungssteigerung in Sport, Beruf und Studium 522
2.6 Rekreationaler Gebrauch 523
2.6.1 Polyvalenter Konsum 523
2.6.2 Erscheinungsbild und Applikationsformen 523
2.6.3 Neue Psychoaktive Substanzen 524
2.7 Gesundheitliche Risiken 525
Literatur 526
Methamphetamin 531
1 Biologisch-naturwissenschaftliche Perspektive 531
1.1 Physis 531
1.2 Pharmakologie 532
1.2.1 Pharmakodynamik 532
1.2.2 Pharmakokinetik 533
1.3 Synthese 533
1.4 Medizinische Anwendung von Methamphetamin 534
2 Sozialwissenschaftlich-epidemiologische Perspektive 534
2.1 Entdeckungs- und Sozialgeschichte 534
2.2 Handelspreis 535
2.3 Gebrauchsformen und -kontexte 535
2.4 Typische Dosis 536
2.5 Risiko Schwarzmarkt und typisch vorgefundene Reinheit 536
2.6 Risiken und Nebenwirkungen 536
2.6.1 Neurotoxizität und Neurokognitive Veränderungen bei chronischem Methamphetaminkonsum 536
2.6.2 Organische Veränderungen durch Methamphetaminkonsum 538
2.6.3 Psychische Veränderungen : Akute Intoxikation, Entzugssyndrom, Abhängigkeit 539
2.7 Behandlung Methamphetamin-assoziierter Erkrankungen 539
2.7.1 Pharmakologische Behandlung 539
2.7.2 Psychosoziale Therapien 540
2.8 Rechtslage 541
2.9 Grad des wissenschaftlichen Erkenntnisstands 541
Literatur 541
MDMA 545
1 Biologisch-naturwissenschaftliche Perspektive 545
1.1 Physis 545
1.2 Pharmakologie 546
1.2.1 Pharmakodynamik 546
1.2.2 Pharmakokinetik 547
1.3 Synthese 547
1.4 Medizinische Anwendung 547
2 Sozialwissenschaftlich-epidemiologische Perspektive 548
2.1 Entdeckungs- und Sozialgeschichte 548
2.1.1 Entdeckungsgeschichte 548
2.1.2 Kulturgeschichtliche Wegmarken 548
2.2 Handelspreis 549
2.3 Gebrauchsformen und -kontexte 549
2.3.1 Epidemiologie 549
2.3.2 Applikationsformen und -kontexte 550
2.4 Typische Dosis 550
2.5 Risiko Schwarzmarkt und typisch vorgefundene Reinheit 550
2.6 Potentiale, Risiken und Nebenwirkungen 551
2.6.1 Subjektive Wirkweise 551
2.6.2 Ausgewählte Berichte 552
Euphorie, Introspektion, mystische Erfahrung 552
Während einer Therapiesitzung mit einem PTBS-Patienten 552
Langzeitgebrauch, Toleranzbildung, Craving 552
Negative Neben- und Nachwirkungen 552
2.6.3 Toxikologie 552
2.6.4 Neurotoxizität 553
2.6.5 Harm Reduction-Hinweise im Umfeld des rekreationalen Gebrauchs 554
2.6.6 Akute Neben- und Nachwirkungen durch MDMA unter kontrollierten Bedingungen 554
2.6.7 Psychiatrische Komplikationen durch MDMA 555
2.7 Rechtslage 555
2.8 Grad des wissenschaftlichen Erkenntnisstands 555
Literatur 556
Cholinergika 560
1 Einleitung 560
2 Überblick Substanzen 561
2.1 Direkte Parasympathomimetika 561
2.2 Indirekte Parasympathomimetika 562
2.3 Substanzen mit muskarinischen und ausgeprägten nikotinischen Wirkanteilen 563
3 Geschichte 563
3.1 Tabak und Nikotin 563
3.2 Betelnusskauen 564
4 Epidemiologie, Konsummuster und kulturelle Kontexte 565
4.1 Betel/Betelnuss 565
4.2 Rauchen 565
5 Pharmakologie (Pharmakodynamik, -kinetik) 566
6 Gesundheitliche Risiken 569
6.1 Risiken des Rauchens 569
6.2 Risiken des Betelkonsums 571
7 Notfallmedizin und Therapie von Missbrauch und Abhängigkeit 572
8 Ausblick 573
Literatur 574
Beruhigungsmittel: Sedativa und Hypnotika 577
1 Einleitung 577
2 Überblick Substanzen 578
3 Geschichte 578
4 Epidemiologie, Konsummuster und kulturelle Kontexte 583
5 Medizinische und wissenschaftliche Anwendungen 585
6 Pharmakologie (Pharmakodynamik,-Kinetik) 588
7 Gesundheitliche Risiken 590
8 Notfallmedizin und Therapie von Missbrauch und Abhängigkeit 591
9 Ausblick 593
Literatur 594
Alkohol 600
1 Einleitung 600
2 Überblick Substanzen 601
3 Geschichte 601
4 Epidemiologie, Konsummuster und Prävention 603
5 Pharmakologie (Pharmakodynamik, -kinetik) 609
6 Gesundheitliche Risiken 612
7 Notfallmedizin und Therapie von Missbrauch und Abhängigkeit 614
8 Ausblick 615
Literatur 615
GHB 621
1 Biologisch-naturwissenschaftliche Perspektive 622
1.1 Physis 622
1.2 Pharmakologie 622
1.3 Medizinische Anwendung 623
2 Sozialwissenschaftlich-epidemiologische Perspektive 624
2.1 Entdeckungsgeschichte 624
2.2 Kulturgeschichtliche Wegmarken 625
2.3 Epidemiologie 625
2.4 Gebrauchsformen und -kontexte 626
2.5 Dosierungen zur Induktion eines veränderten Bewusstseinszustandes 627
2.6 Typische Reinheit 627
2.7 Rechtslage 627
3 Potenziale, Risiken und Nebenwirkungen: Subjektive Wirkung und toxikologische Befunde 627
3.1 Subjektive Wirkung 627
3.2 Toxikologie 628
4 Quellenlage 630
4.1 Grad des wissenschaftlichen Erkenntnisstands 630
Literatur 630
Opioide 633
1 Einleitung: Schlafmohn, Opiate, Opioide – Begriffsklärung 634
2 Überblick Substanzen 634
3 Geschichte der Opioide 635
3.1 Opium, der Saft des Schlafmohns 635
3.2 Morphin und Codein 635
3.3 Diacetylmorphin (DAM, Heroin, Diamorphin) 636
4 Epidemiologie, Konsummuster und kulturelle Kontexte 637
4.1 Epidemiologie von Opioidkonsum und -abhängigkeit 637
4.2 Konsummuster 638
4.3 Kulturelle Kontexte 638
5 Pharmakologie: Opioide und Opioidrezeptoren 638
6 Psychotrope und sonstige Wirkung – Medizinische und nicht medizinische Verwendung 639
6.1 Medizinische Verwendung 639
6.2 Nicht medizinische Verwendung 639
7 Gesundheitliche Risiken – Überdosierung und Abhängigkeit 640
7.1 Opioidüberdosierung 640
7.2 Opioidabhängigkeit, deren Folgen und Begleitumstände 640
8 Notfallmedizin und Therapie von Missbrauch und Abhängigkeit 641
8.1 Behandlung der Opioidüberdosierung 641
8.2 Opioidentzugssyndrom und dessen Akutbehandlung 641
8.3 Behandlungsansätze der Post-Akutbehandlung 642
8.3.1 Die substitutionsgestützte Therapie der Opioidabhängigkeit 642
8.3.2 Substitutionsmittel 643
9 Ausblick 644
Literatur 645
Phytocannabinoide 648
1 Einleitung 648
2 Cannabisbestandteile 649
3 Die Aufklärung der chemischen Struktur der Phytocannabinoide 649
4 Cannabinoide der Hanfpflanze 650
4.1 Delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC, Dronabinol) und seine pharmakologischen Wirkungen 650
4.1.1 Die Pharmakokinetik von THC 651
4.1.2 Wechselwirkungen von THC mit anderen Substanzen 652
4.1.3 Die medizinische Verwendung von THC und Cannabis 652
4.1.4 Toleranzentwicklung und Abhängigkeit durch THC 653
4.2 Cannabidiol (CBD) 653
4.2.1 Die medizinische Verwendung von CBD 653
4.2.2 Wechselwirkungen von CBD mit anderen Substanzen 653
4.3 Weitere Phytocannabinoide der Hanfpflanze 654
4.3.1 Tetrahydrocannabivarin (THCV) 654
4.3.2 Cannabichromen (CBC) 654
4.3.3 Cannabigerol (CBG) 654
5 Phytocannabinoide in anderen Pflanzen 655
5.1 Strohblumen (Helichrysum) 655
5.2 Lebermoose (Radula) 655
5.3 Echinacea purpurea 655
5.4 Beta-Caryophyllen 655
Literatur 655
Ausführliche Beiträge zur Pharmakologie und Pharmakokinetik der Cannabinoide finden sich online hier 656
Psychedelika 657
1 Einleitung 658
2 Überblick Substanzen 658
3 Geschichte 658
4 Sozialgeschichte 660
5 Medizinische und wissenschaftliche Anwendung 662
6 Epidemiologie, Konsummuster und kulturelle Kontexte 662
7 Pharmakologie 663
8 Subjektive Wirkung 664
9 Gesundheitliche Risiken 665
10 Notfallmedizin und Therapie von Missbrauch und Abhängigkeit 666
11 Ausblick 666
Literatur 666
Dissoziativa 671
1 Einleitung 672
2 Überblick Substanzen 672
3 Geschichte 673
3.1 Phencyclidin (PCP) 673
3.2 Ketamin 673
3.3 Dextrometorphan (DXM) 674
4 Epidemiologie, Konsummuster und kulturelle Kontexte 675
5 Medizinische und wissenschaftliche Anwendungen 676
6 Pharmakologie 677
7 Gesundheitliche Risiken 681
8 Therapie von Abhängigkeit und Komplikationen 683
9 Ausblick 683
Literatur 683
Anticholinergika 688
1 Einleitung 688
2 Überblick der anticholinergisch wirksamen Substanzen und Pflanzen 689
2.1 mAChR-Antagonisten 689
2.2 Vorkommen von Anticholinergika in Pflanzen 689
3 Geschichte der Tropan-Alkaloide 693
4 Epidemiologie, Konsummuster und kulturelle Kontexte 696
5 Pharmakologie (Pharmakodynamik, -kinetik) der Anticholinergika 696
5.1 Pharmakodynamik der Anticholinergika 696
5.2 Physiologische Wirkungen der Anticholinergika und Vergiftungssymptome 697
5.3 Pharmakokinetik der Anticholinergika 698
6 Gesundheitliche Risiken der Anticholinergika 698
6.1 Toxikologie der Tropan-Alkaloide 698
6.2 Vergiftungen durch Pflanzen 698
7 Notfallmedizin 699
8 Ausblick 699
Literatur 700
| Erscheint lt. Verlag | 3.11.2017 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Springer Reference Psychologie |
| Verlagsort | Berlin |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Geisteswissenschaften ► Psychologie ► Allgemeine Psychologie |
| Medizin / Pharmazie ► Medizinische Fachgebiete ► Psychiatrie / Psychotherapie | |
| Studium ► 1. Studienabschnitt (Vorklinik) ► Biochemie / Molekularbiologie | |
| Technik | |
| Schlagworte | Drogenkonsum • Drug Science • Handelswege psychoaktiver Substanzen • Legal Highs • Lufterfrischer, Reiniger, Badesalze, Ecstasy • Missbrauch von Drogen • Nebenwirkungen, Angstzustände • Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz – NpSG • Novel Psychoactive Substances • psychoaktive Kräuterrmischungen • Psychoaktive Substanzen, Klassen, Subgruppen und Substanzen • Psychoaktive Substanzen, Politik, Medizin, Publistik • Psychoaktiv, neue und alte Drogen • Rauschzustände • Research Chemicals • Stimulanzien • Substanzen, Cannabinoiden • Wirkstoffdesign |
| ISBN-10 | 3-642-55125-4 / 3642551254 |
| ISBN-13 | 978-3-642-55125-3 / 9783642551253 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich