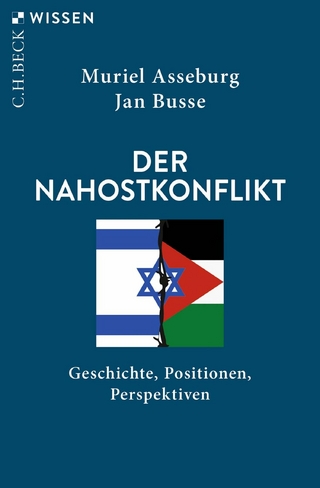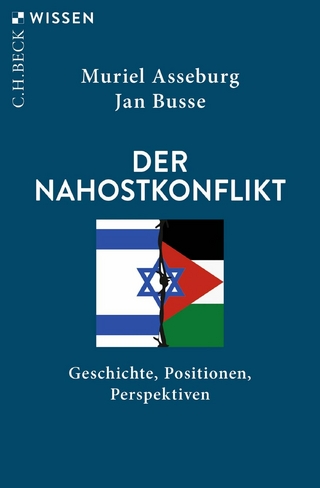Für, gegen und ohne Kommunismus (eBook)
312 Seiten
C.H.Beck (Verlag)
978-3-406-74104-3 (ISBN)
Für den Kommunismus: Das begann schon damit, dass die Rote Armee im Januar 1945 die Mauern des Budapester Ghettos durchbrochen hatte. Dadurch bewahrte sie den 1943 geborenen György und seine Eltern vor dem Abtransport in ein deutsches Vernichtungslager. Ohne den Kommunismus: Das war das Resultat des Ernüchterungsprozesses, dem sich der kommunismustrunkene Geschichtsstudent in der sowjetischen Wirklichkeit ausgesetzt sah. Ebenso unerwartet begann über Nacht im Jahr 1968 das Leben als Dissident gegen den Kommunismus, als der nach Ungarn zurückgekehrte Schriftsteller wegen angeblicher maoistischer Umtriebe zu sieben Monaten Haft verurteilt wurde.
Schonungslos gegen sich selbst erzählt der mit dem Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung ausgezeichnete Publizist und Historiker die Geschichte seines Lebens und zugleich die Geschichte der großen Lebenslüge namens real existierender Sozialismus von 1956 bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion 1990.
György Dalos ist freier Autor und Historiker. 1995 wurde er mit dem <i>Adelbert-von-Chamisso-Preis </i>ausgezeichnet. 2010 erhielt er den L<i>eipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung</i>.<br>
Cover 1
Titel 4
Impressum 5
Widmung 6
Inhalt 8
PRÄLUDIUM: Frühe Deutschstunden 10
1. KAPITEL: Russland, bevor ich es kennenlernte 36
2. KAPITEL: Moskau, frühe Sechzigerjahre 56
3. KAPITEL: Sturm oder Drang 78
4. KAPITEL: Begegnungen mit der Weltgeschichte 102
5. KAPITEL: Das Schaltjahr 1968 126
6. KAPITEL: Vom Umdenken zum Hungerstreik 150
7. KAPITEL: Jahre der Windstille. 1971–1976 176
8. KAPITEL: Das zweite Buch 206
9. KAPITEL: Hin- und hergerissen 230
10. KAPITEL: Der lange Abschied 256
11. KAPITEL: Simonygasse 2/6 280
Personenregister 303
Zum Buch 314
1. KAPITEL
Russland, bevor ich es kennenlernte
Bei öffentlichen Auftritten im deutschen Sprachraum wird mir manchmal, hauptsächlich von im Westen der Republik sozialisierten älteren Zeitgenossen, die Frage gestellt: Wie konnte ich mich «nach alledem», was ich im Herbst 1956, wenn auch als zwölfjähriges Kind, auf Budapester Straßen gesehen hatte, dem Kommunismus, speziell der Sowjetunion respektive Russland zuwenden? Diesen in Frageform verpackten, nicht immer höflich formulierten Vorwurf versuche ich zu entkräften, indem ich, auf ein eventuell vorhandenes Humorgefühl des Publikums schielend, den kapriziösen Stimmungswechsel der Pubertät als Argument anbringe. Gleichzeitig erscheint mir der Versuch, alles auf die Hormone abzuwälzen, unbefriedigend. Jedenfalls habe ich für meinen Sinneswandel auch weniger biologische Erklärungen parat.
So elementar und unwiderstehlich das Pathos des Volksaufstands auch war, so schnell und geräuschlos löste es sich in der Luft der späten fünfziger Jahre wieder auf, fast ohne Spuren zu hinterlassen. Der wichtigste Grund hierfür lag zweifelsohne in der Niederschlagung des Aufstands durch die Rote Armee und dem darauffolgenden Rachefeldzug mit Hunderten von Hinrichtungen. Zehntausende wurden interniert oder kamen ins Gefängnis. Hinzu kam die Fluchtbewegung. Wenn aus einem Land, das nur zehn Millionen Einwohner hat, zweihunderttausend Menschen fliehen, dann ist das nicht nur eine Zahl in der Statistik, sondern wird Bestandteil einer schmerzhaften Erfahrung sehr vieler Familien. Diejenigen, die das Land nicht verlassen wollten oder konnten, mussten die Illusion einer Hilfe aus dem Westen – etwa in Gestalt von UNO-Truppen – als Fata Morgana erkennen, und diese Ernüchterung hatte bei aller Tragik etwas Beruhigendes. Den meisten blieb nur, das sich neu etablierende System als Teil der einzig möglichen Weltordnung zu betrachten und ihr Glück im Rahmen des Bestehenden zu suchen.
Die Staatsmacht selbst war trotz allen ausgeübten Terrors offensichtlich zu der Einsicht gelangt, dass das Land nach dem Oktober 1956 nicht mehr ganz so wie zuvor regiert werden konnte. So ergaben sich einige positive Änderungen, von denen einige sogar aus der Logik entstanden, endlich wieder für Ordnung sorgen zu wollen. Noch monatelang nach der Zerschlagung der bewaffneten Gruppen herrschte der Ausnahmezustand, unter anderem war jede Menschenansammlung auf offener Straße strikt verboten. Natürlich gab es eine für alle Ostblockstaaten signifikante Ausnahme: die Schlangen vor den Lebensmittelläden, die in all ihrer Reizbarkeit wie regierungsfeindliche Zusammenrottungen wirkten. Für dieses Problem wurde eine wahrhaft originelle Lösung gefunden: Man füllte die Regale mit den wichtigsten Lebensmitteln und verbesserte auch das Angebot deutlich. Die Surrogate der frühen Fünfzigerjahre – Eipulver, Zitronentabletten, Kunsthonig und Ähnliches – wichen normalen Lebensmitteln und Süßigkeiten, und zu Weihnachten gab es sogar Orangen und Bananen. Noch auffälliger war, dass der Staat sich nun um die Instandsetzung der von ihm enteigneten Wohnflächen zu kümmern begann. Hauptstadtweit wurden Renovierungen auf Staatskosten durchgeführt. Auch unsere kleine Wohnung am Leninring wurde frisch gestrichen, und wir bekamen, neben dem alten, mit Kohle betriebenen Küchenherd, einen Gaskocher mit zwei Brennern, eine wahre soziale Wohltat. Jeder weitere denkbare Komfort – ein Badezimmer mit fließend warmem Wasser und eine Zentralheizung – blieb noch lange ein unerfüllter Traum.
Abb. 7 Der Hof des Hauses Leninring 101, in dessen erstem Stock unsere Familie seit 1928 eine Zweizimmerwohnung gemietet hatte
Die von der sowjetischen Militärtechnik arg beschädigte Stadt wurde nach und nach wiederhergestellt. Auf der Rákóczi-Straße, Hauptverkehrsader der Metropole, errichtete man mit viel architektonischer Finesse vor den zerstörten Toreinfahrten Wandelgänge. Die «Arkadisierung» galt als besonders «modern», obwohl strenggläubige Genossen das westliche Wort mieden und es lieber durch Ausdrücke wie «fortschrittlich» oder «zeitgemäß» ersetzten. Jedenfalls gaben die Arkaden der Stadt ein anderes Gesicht. Als junger Mensch flanierte ich gern zwischen dem Ostbahnhof und dem Donauufer oder auch zwischen dem Westbahnhof und dem Nationaltheater und bewunderte die Geschäfte, deren Schaufenster immer reichhaltiger wurden. Am meisten faszinierte mich das Schaufenster eines Elektrogeschäfts am Platz des Siebten November, in dem das erste ungarische Tonbandgerät – die Leute nannten es «Magnetophon» – zum Verkauf angeboten wurde. Durch ein offenes kleines Fenster durfte man sogar ein paar Worte sprechen, deren Wiedergabe eine halbe Minute später erfolgte. Ich stellte mich sofort in die Schlange der Neugierigen, sprach meinen Namen und die Adresse in das Mikrophon mit dem blinkenden grünen Signallicht und hörte dann meine vor Aufregung heisere, mutierende Stimme als Zeichen meiner Zugehörigkeit zur modernen technischen Zivilisation.
Die Sowjetunion meiner Kindheit war vom Großen Vaterländischen Krieg geprägt worden. Auf einem bekannten Plakat sah man den Sowjetsoldaten, wie er ein ungarisches Kleinkind auf dem Arm hielt und gleichzeitig an hungernde Magyaren Brot verteilte. In den Filmen rollten die T-34-Panzer auf ihren Raupenketten gen Berlin, um die faschistische Bestie in der eigenen Höhle zu vernichten. Nach dem Krieg schienen im Land des siegreichen Sozialismus paradiesische Zustände zu herrschen. Jeden Sommer kam es zu einer neuen Rekordernte, man baute an Industriegiganten und glaubte an die lichte Zukunft der nächsten Generation, genauso, wie ich es beim freiwilligen Lernen des kyrillischen Alphabets einer sowjetischen Fibel entnommen hatte: «Sascha wird zum Traktoristen,/Petja wird zum Maschinisten/und Serjoscha-Pionier,/wird gewiss zum Ingenieur.»
Das war noch die reine Stalin-Zeit, die «netto» bis zum 5. März 1953, dem Todestag des Sowjetführers, dauerte. Merkwürdigerweise fiel dieses Ereignis mit dem 64. Geburtstag meiner Großmutter zusammen. Ich bastelte im jüdischen Internat an einer gereimten Grußadresse zu dem feierlichen Anlass, die ich ihr in maximaler Schönschrift am Wochenende persönlich auszuhändigen gedachte: «Heute schreib ich ein Gedicht/und das ist kein Zufall nicht./Oma hat Geburtstag heut/was mein Herz gar sehr erfreut.» Die äußeren Umstände begünstigten eindeutig die Dichtkunst: Unsere Erzieher und Erzieherinnen forderten an diesem Tage Mäuschenstille auf der ganzen Linie ein, auch sie selbst schienen auf Zehenspitzen zu gehen. Vielleicht ging es dabei nicht einmal um Trauer, sondern um die Angst vor dem, was nun kommen würde. «Was wird nun aus solchen wie uns?», war ein Satz, den ich aus ihren Gesprächsfetzen heraushörte. Immerhin lag das, was wir Hebräer überlebt hatten, knappe acht Jahre zurück. Stalin wurde von fast allen Juden in Ehren gehalten, eben als Verkörperung der Sowjetunion, deren Rote Armee die Ghettomauern im Januar 1945 durchbrochen hatte.
Dass der Kremlchef zu Beginn seiner Karriere Posträuber gewesen war, wie mir Tante Jenny vertraulich mitteilte, beeindruckte mich nur wenig: Als Krimineller hatte er sich gewiss unanständig benommen, doch als Befreier, so dachte ich, hatte er seine Jugendsünden in beeindruckender Weise korrigiert. Einige Jahre darauf wurde ihm auf dem XX. Parteitag von seinem Nachfolger Nikita Chruschtschow viel Schlimmeres als ein banaler Angriff auf irgendwelche Geldtransportwagen im Kaukasus vorgeworfen, und wenig später bewegten sich die legendären Panzer T-34 von der Kinoleinwand hinweg und fuhren direkt durch die Straßen unserer Stadt. Als glühender dreizehnjähriger Patriot war ich darüber höchst empört und besuchte meinen geliebten Klassenlehrer, der im Frühjahr 1957 verhaftet worden war, im Internierungslager Tököl. Dennoch habe ich den Volksaufstand, unsere «kleine Oktoberrevolution», im Unterschied zu vielen anderen Jugendlichen nicht als schicksalsbestimmend erlebt. Meine Verurteilung der sowjetischen Invasion blieb auf diesen Einzelfall beschränkt und hatte mit dem Frühjahr 1945 nichts zu tun. Der Impuls der Dankbarkeit gegenüber den Lebensrettern war bei mir stärker als die Ablehnung des Kommunismus und der sowjetischen Ideologie, die ich wegen meines damaligen festen Gottesglaubens nicht annehmen konnte.
Wenn man als heranwachsender Jude in Ungarn zu denen gehörte, die das «Tagebuch der Anne Frank» lasen, das auf Ungarisch 1958 erschienen war, dann fühlte man sich spontan von der politischen Kraft angezogen, die dem Leid zumindest temporär ein Ende gesetzt hatte. Dabei lebte ich in einer Gesellschaft, in der das Wort «Russland» oder «die ...
| Erscheint lt. Verlag | 19.9.2019 |
|---|---|
| Übersetzer | Elsbeth Zylla |
| Zusatzinfo | mit 18 Abbildungen |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Biografien / Erfahrungsberichte |
| Geisteswissenschaften ► Geschichte ► Regional- / Ländergeschichte | |
| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung | |
| Schlagworte | 20. Jahrhundert • Biografie • Biographie • Dissident • Erinnerung • Geschichte • György Dalos • Jude • Kommunismus • Politik • Schriftsteller • Ungarn |
| ISBN-10 | 3-406-74104-5 / 3406741045 |
| ISBN-13 | 978-3-406-74104-3 / 9783406741043 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 8,7 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
Größe: 3,9 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich