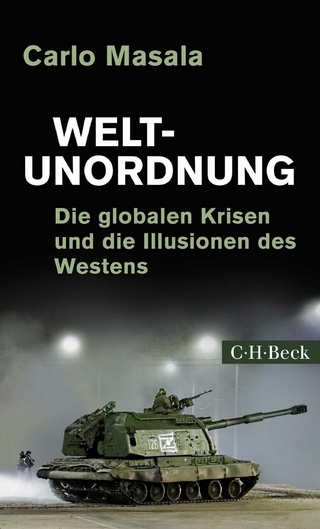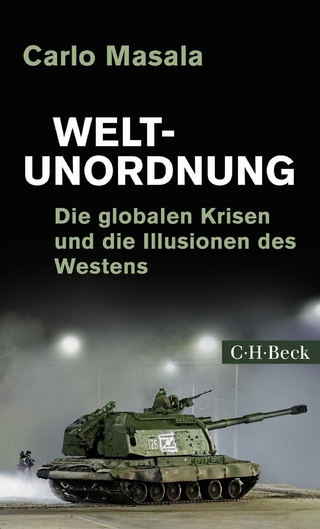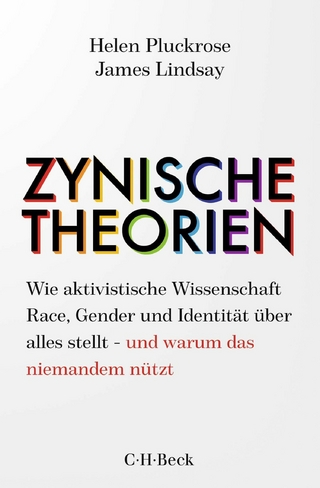Feminismus - Die älteste Menschenrechtsbewegung der Welt (eBook)
384 Seiten
DuMont Buchverlag
978-3-7558-1019-3 (ISBN)
AGNES IMHOF, geboren 1973 in München, studierte Philosophie und promovierte in Islam- und Religionswissenschaften. Sie spricht unter anderem Arabisch, Persisch und Italienisch und ist in klassischem Gesang ausgebildet. Sie ist freie Publizistin mit Sachbuch- und Romanpublikationen. Seit 2016 lehrt sie an der FAU Erlangen und hält Lehrveranstaltungen an den Universitäten Bamberg, München (LMU), Göttingen, Erlangen und Würzburg.
Klassiker des Feminismus
LYSISTRATES SCHWESTERN
Als der Dichter Aristophanes im Jahr 411 vor unserer Zeitrechnung seine Komödie Lysistrate auf die Bretter brachte, ging der Peloponnesische Krieg zwischen Athen und Sparta ins zwanzigste Jahr. Auf der Bühne wird es den Frauen von Athen zu bunt. Nicht genug, dass sie ihre Ehemänner vermissen und der Krieg zahllose Leben kostet, die Sanktionen sorgen auch dafür, dass selbst der Nachschub an Dildos aus Kleinasien versiegt ist (olisbos: »Lederphallus«). Handeln tut not, beschließt die Athenerin mit dem sprechenden Namen Lysistrate (»die das Heer auflöst«). Sie beruft eine Versammlung zum Thema »Frieden schaffen ohne Waffen« ein. Das Ergebnis: Sexstreik, so lange, bis die Männer den Krieg beenden. Da sich alle Schätze, mit denen der Krieg finanziert wird (also gewissermaßen die Bank von Athen), auf der Akropolis befinden, wird diese kurzerhand von den Frauen besetzt. Der Plan geht auf: Da auch die Spartanerinnen und selbst die Prostituierten mitstreiken, kriechen Athener wie Spartaner bald gebückt und gepeinigt von zentnerschweren Dauererektionen über die Bühne. Am Ende wird tatsächlich Friede geschlossen, zwischen Athen und Sparta ebenso wie zwischen Männern und Frauen. Aphrodite sei Dank!
Natürlich ist das Stück von zeittypischen Geschlechterklischees geprägt: Die Frauen sind stark auf den Aspekt von Sex und Familie reduziert, ihre Verschwörung ist komisch, und am Schluss wird die »gute alte Ordnung« wiederhergestellt. Aber dennoch: In einer Welt, in der Frauen weder wählen konnten noch sonst irgendwelche Bürgerrechte besaßen, setzt sich hier eine weiblich-pazifistische Position gegen die männlich-kriegerische durch. Die Frauen – die im Athen dieser Zeit kaum das Haus verlassen durften – besetzen erfolgreich die Burg und konfiszieren die Finanzen, ohne die es keinen Krieg gibt. Dank der massiven Tore und ein paar Handgreiflichkeiten gelingt es ihnen auch, ihre Beute zu halten. Frauen erkämpfen die Teilhabe an politischen Entscheidungen, die ihnen rein rechtlich versagt ist. Vernunft siegt über Kriegsgeschrei, und was vorher um jeden Preis mit Waffen ausgetragen werden sollte, kann nun auf einmal auch am Verhandlungstisch geregelt werden.
Auch wenn Lysistrate eine Theaterheldin bleibt (und wie damals üblich von einem Mann gespielt wurde): Auch im realen Leben kam es durchaus schon in der Antike vor, dass Frauen für mehr Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und an dessen Ressourcen kämpften. Vermutlich im 3. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung praktizierte die Athenerin Hagnodike als Mann verkleidet illegal als Ärztin und Geburtshelferin. Frauen und (andere) Sklav*innen durften damals keine Ärzte sein. Doch bei den Damen der besseren Gesellschaft kam die Gynäkologin verständlicherweise gut an. Und so kam es dann zu einem gewaltigen Justizskandal: Neider hatten Hagnodikes Scharade entlarvt und sie vor Gericht gezerrt. Doch ein Mob wütender Frauen, hauptsächlich ihre oft hochgestellten Patientinnen, soll unversehens dort aufgekreuzt sein, Richter und Ankläger beschimpft und Hagnodikes Freispruch verlangt haben. Den sie dann auch bekamen.19
Auch wenn es nirgends so benannt wird: Der Fall Hagnodike ist ein Sieg universaler Menschenrechte über das zeitgebundene Rechtssystem. Zufall vielleicht, dass »Hagnodike« im Deutschen etwa so viel bedeutet wie »heiliges (bzw. reines) Recht«. Aus Sicht der Athener war es alles andere als das: Für sie ließ sich ein Richter beeinflussen, weil er Angst vor den einflussreichen Männern von Hagnodikes Patientinnen hatte. Aus moderner Sicht fordern Frauen ihre unveräußerlichen Rechte ein, die ihnen eben auch ein diskriminierendes Rechtssystem nicht nehmen kann. So alt wie die Diskriminierung der Frauen ist ihr Kampf dagegen.
Wir wissen nicht, wann genau die Diskriminierung der Frauen begonnen hat. Doch es gibt gute Gründe, die Anfänge in der Zeit der neolithischen Revolution anzusetzen: dem Moment, als die Menschen sesshaft wurden. Funde aus der Altsteinzeit, als die Menschen noch Jäger*innen und Sammler*innen waren, lassen annehmen, dass Frauen damals nicht diskriminiert wurden. Die Idee, dass Frauen das »schwache Geschlecht« seien, existierte nicht. Die Gruppe sorgte gemeinsam für das Überleben und war egalitär organisiert, meinen aktuelle Publikationen. Frauen jagten und zogen bei Bedarf auch in den Krieg – übrigens nicht nur in der Steinzeit, sondern auch noch viel später.20 Insgesamt habe die Sesshaftwerdung im Neolithikum die Position der Frauen geschwächt: Durch die veränderte Ernährung sei früher abgestillt worden, sodass die Frauen öfter schwanger wurden. In der Bronzezeit habe sich dann eine geschlechtsspezifische Ernährung durchgesetzt: Frauen hätten weniger Fleisch bekommen, sodass ihre geringere Größe möglicherweise auch dadurch bedingt sei. Besitz entstand, der beschützt und vererbt werden konnte: So sei einerseits körperliche Stärke aufgewertet worden, andererseits die Sexualität der Frauen überhaupt erst kontrolliert worden, denn erst jetzt wurde die Abstammungslinie wichtig. Da dementsprechend Söhne in der Familie blieben und die Frauen von auswärts einheirateten, sei ihre Stellung in der Familie des Mannes entsprechend schwach gewesen. Möglicherweise ist die Geschlechterhierarchie also historisch gesehen ein Sonderfall und reicht nicht sehr weit zurück.21
Tatsächlich weisen anthropologische Forschungen nach, dass es seit der Bronzezeit eine geschlechtsspezifische Diät gab.22 Allerdings wird die Größe eines Menschen auch noch durch andere Faktoren bestimmt. Und es bleibt die Frage, was Ursache und was Wirkung ist. Warum erhielten die Frauen weniger nährstoffreiches Essen, wenn nicht aus dem Grund, dass Männer bereits höher geschätzt wurden? Fleischkonsum kann – wie der Konsum hochwertiger Nahrung allgemein – als Gradmesser des sozialen Status gesehen werden: Auch Josephine Peary berichtete von ihrer ersten Arktis-Expedition Ende des 19. Jahrhunderts in My Arctic Journal, die nordgrönländischen Frauen hätten davor zurückgescheut, Eier zu essen, weil diese Männern vorbehalten waren23 – und hier handelte es sich um eine reine Jägerkultur. »Das größte Stück für Papa«: Die Nachkriegsgeneration hat erlebt, dass bei Nahrungsmittelknappheit das angesehenste Gruppenmitglied am meisten erhält. Die geschlechtsspezifische Nahrungsverteilung ist also eher Folge des Patriarchats, nicht seine Ursache.
In matrilinearen Kulturen wird Besitz über die mütterliche Linie vererbt, auch Besitz kann damit nicht als Grund fürs Patriarchat angeführt werden. Bei den Hopi hat Sesshaftigkeit die Stellung der Frauen sogar verbessert, da ihnen Haus und Land gehören. Die Interpretation, der Hackbau habe die Vorherrschaft der Männer befördert, ist ebenfalls unbefriedigend, denn bei den nordamerikanischen Stämmen sind es gerade die Hackbaukulturen, die am stärksten matrifokal (also mutterzentriert) aufgebaut sind.24 Angela Saini nimmt in ihrem Buch Die Patriarchen an, das Patriarchat sei mit der Staatlichkeit aufgekommen. Als Arabistin kann ich allerdings sagen, dass Staatenlosigkeit kein Widerspruch zum Patriarchat sein muss: Bei den altarabischen staatenlos organisierten Stämmen finden sich patriarchalische, aber auch solche, die matrifokale Tendenzen erkennen lassen. Auch die Inuit sind ein Beispiel für eine staatenlose, tendenziell patriarchalische Kultur. Umgekehrt gibt es Hinweise auf frühstaatliche matrifokale Kulturen, wie wir im Kapitel über das Matriarchat sehen werden.25 Insofern überzeugt mich die Archäologin Marija Gimbutas, die das Patriarchat als eine Frage der Kultur definiert. Möglicherweise lag Johann Jakob Bachofen im 19. Jahrhundert in Das Mutterrecht richtig, als er die Frage mit der Reproduktion verband26: Legitimiert wurde die Unterdrückung der Frauen laut Bachofen nämlich durch die Idee, der Mann sei der eigentliche Schöpfer bei der Fortpflanzung, die Frau hingegen nur das Gefäß, gewissermaßen der Ackerboden, der ohne den männlichen Samen eben unfruchtbar bleibt. Diese Idee sei erst nach der Sesshaftwerdung aufgekommen. Mit diesem Argument wird der griechische Muttermörder Orestes vor dem Athener Areopag freigesprochen: Da er seine Mutter getötet hatte, um seinen Vater zu rächen, habe er das überlegene Schöpfungsprinzip verteidigt.27 Auch Gena Corea nahm an, dass Vaterschaft erst die Unterwerfung der Frau ermöglicht habe.28 Die neolithische Revolution hat ein strenges Patriarchat (etwa mit geschlechtsspezifischer Diät) erst möglich gemacht, doch das Patriarchat war keineswegs die notwendige Folge der neolithischen Revolution. Warum stellen die modernen Ansätze diese so offensichtlichen Fragen nicht?
Oft ist zu lesen, das Patriarchat sei mit Gewalt verbreitet worden. Aus der osmanischen Geschichte wissen wir in der Tat, dass der Expansionsdrang (»Aggressivität«) einer Kultur durch ganz banale ökonomische Anreize entstehen kann: Das osmanische Reich war auch deshalb so expansiv, weil es zeitweise seine Krieger mit Gütern der von ihnen eroberten Gebieten bezahlte. Vorislamische arabische Stämme hatten unterschiedliche Kategorien, das Ansehen und damit den Einfluss eines Mannes zu definieren: etwa über die Abstammung oder über Freigiebigkeit (Gastfreundschaft), aber eben auch durch Kriegstugenden.29 Der Begriff muruwwa (wörtlich »Männlichkeit«, aber gemeint als »Tugend«, ähnlich wie beim lateinischen Wort virtus) definiert hier ein maskulines Ideal, das auch kriegerische Fähigkeiten umfasste. Es ist also denkbar,...
| Erscheint lt. Verlag | 15.5.2024 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Politik / Gesellschaft |
| Recht / Steuern ► Allgemeines / Lexika | |
| Recht / Steuern ► EU / Internationales Recht | |
| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung | |
| Schlagworte | Alica Schwarzer • Amazonen • Antike • bell hooks • Betty Friedan • Christine de Pizan • Clara Zetkin • Die Geschichte des Feminusmus • Diskriminierung • Dritte feministische Welle • Emma Goldman • Emmeline Pankhurst • Erste feministische Welle • Feminismus • Feminismus in den • Französische Revolution • Frauenbewegung • Gendern • Geschenke für Feministen • geschenke für feministinnen • Gleichberechtigung • Hedwig Dohm • Historie • Kate Millet • Louise Otto Peters • Marie de Gournay • Menschenrechte • Mittelalter • Neuzeit • Olympe de Gouges • Patriarchat • Reformjudentum • Rollenverteilung • Simone de Beauvoir • Sophie Passmann • Suffragetten • Wahlrecht • Zweite feministische Welle |
| ISBN-10 | 3-7558-1019-0 / 3755810190 |
| ISBN-13 | 978-3-7558-1019-3 / 9783755810193 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 2,6 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich